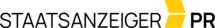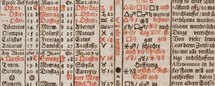Die Pressesprecher brauchen mehr als einen guten Draht zur Lokalzeitung
Digitale und soziale Medien durchdringen den Alltag, die Lokalpresse ist auf dem Rückzug. Diese Entwicklung erfordert von Pressesprechern der Verwaltung, sich auf neue Aufgaben und Rollen einzustellen. Das zeigte das Symposium „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung“ des Staatsanzeigers.
Stuttgart. „Amt 4.0 – erfolgreich digital kommunizieren“, hatte der Staatsanzeiger sein diesjähriges Symposium überschrieben. Gut 160 Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus allen Bereichen der Verwaltung im Südwesten kamen am Montag in Stuttgart zusammen, um sich über diese digitale Kommunikation ganz analog auszutauschen. „Sowohl Individual- als auch Massenkommunikation verlagern sich mehr und mehr in die digitale Sphäre“, stellte Chefredakteurin Breda Nußbaum zur Begrüßung fest. Darauf liege daher das Augenmerk an diesem Tag.
Wie sich Kommunikationsverhalten ändert und welche Folgen das für die Pressesprecher hat, zeigte im Impulsvortrag Wolfgang Schweiger, Professor für Kommunikationswissenschaft insbesondere interaktive Medien- und Onlinekommunikation an der Universität Hohenheim. Zusammen mit einer Mitarbeiterin hatte er im Herbst in drei Beispielkommunen untersucht, wer bei einem bestimmten kommunalen Thema mit wem worüber kommuniziert. „Eines hat uns überrascht: Es sind immer noch die guten alten Lokalzeitungen, die das Feld dominieren“, berichtete Schweiger.
Den vollständigen Bericht lesen Sie in der Ausgabe 11 des Staatsanzeigers auf Seite 16.

Barbara Lohner, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinde Oberderdingen
Ich finde es immer gut, dass man sich auf einem solchen Symposium mit Kollegen aus anderen Kommunen unterhält. Man bekommt mit, was dort läuft, wo die Probleme liegen. Durch die Fachvorträge bekommt man neue Impulse und kann diese auf seine Arbeit übertragen. Dass man zwei Fachforen aussuchen und Schwerpunkte setzen kann, finde ich gut. Ich hatte mir Social Media bei Daniela Vey ausgesucht, weil das immer wichtiger wird – auch in der Kommune. Jetzt gehe ich in das Fachforum Texten für Web und Social Media, weil es ja speziell ist im Vergleich zum Artikel im Amtsblatt, dort den richtigen Ton zu treffen und seine Follower anzusprechen.

Ulrich Spitzmüller, Pressesprecher, Landratsamt Emmendingen
Es war heute ein interessanter Tag, viel Hintergrund, viel Basis. Gut fand ich die Praxisbeispiele heute Mittag aus dem Workshop zur Pressearbeit in kleinen Gemeinden. Heute Morgen die Vorträge haben eine Sensibilität vermittelt, worauf es ankommt. Gut fand ich, dass es heute keinen inhaltlichen Spannungsabfall gab. Die Mischung zwischen wissenschaftlicher Basis und Praxis war gut. Ich bin heute gekommen, weil bei uns die Entscheidung ansteht, ob Social Media ein Weg ist, und wenn ja, was. Dazu nehme ich einiges mit.

Susanne Uhrig, Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, Landratsamt Rhein-Neckar
Ich war jetzt im Fachforum Soziale Medien. Wir sind schon in vielen sozialen Medien aktiv: Twitter, Youtube und Instagram. Dennoch war es interessant, zu hören, was für Behörden aus Sicht der Fachleute noch möglich ist. Zwar reicht unsere personelle Ausstattung nicht, um das noch weiter auszubauen. Aber wir sind ja schon sehr gut aufgestellt. Vor allem die Krisenkommunikation ist für Behörden immer ein großes Thema. Der Vortrag war auf jeden Fall hilfreich, weil die Polizei die Nase vorn hat, was die Krisenkommunikation angeht.

Siegfried Fiedler, Projektleiter Marketing, Informationszentrum Beton
Beide Vorträge heute Morgen waren sehr gut. Der Professor aus Hohenheim hat einen schönen Überblick gegeben, wie wir zum Netzwerker werden zwischen innen und außen. Den Vortrag über die Krisenkommunikation fand ich sehr gut, weil er einen Einblick gegeben hat, wie man in der Krise über soziale Medien kommunizieren kann. Ein Herr sagte, er hätte es sich detaillierter gewünscht. Aber wenn man mal einen Schritt zurücktritt und analysiert, wie es die Polizei gemacht hat, kann man etwas daraus lernen. Ich bin jetzt das vierte Mal dabei, das Pressesprecher-Symposium ist jedes Mal eine tolle, runde Sache.

Petra Schneppe, Pressereferentin, Allgemeine Ortskrankenkasse Neckar-Fils
Gerade zum Thema Digitalisierung und Social Media habe ich viele Anregungen erhalten und viel Neues gelernt. Ich versuche, diese Infos in meine Arbeit zu integrieren. Vieles machen wir schon, aber man nimmt doch immer wieder etwas mit. Zum Beispiel, was Professor Jarolimek angesprochen hat mit „Twitch“. Das ist neu, das habe ich von meinem Sohn auch gehört. Krisenmanagement ist für uns immer wieder ein Thema. Sich bewusst zu machen: Das sind die Tools, so muss man arbeiten, das nehme ich positiv mit. Das Symposium ist immer wieder sehr gut vorbereitet und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr mit dem Thema Digitalisierung weitergeht.

Ulrich Reich, Pressesprecher, Stadt Oberkirch
Von Professor Jarolimek nehme ich mit, dass man sich im Vorfeld nicht genügend Gedanken zum Thema Krise und Umgang mit der Krise machen kann. Im Großen, also fachbereichsübergreifend, aber auch für den einzelnen Bereich, damit man vorbereitet ist. Bei uns gibt es eine öffentliche Facebook-Gruppe, wo vieles einfach eingestellt wird, obwohl jemand nur einen Ausschnitt mitbekommen hat. Wenn es sehr auf Stammtisch-Niveau ist, überlegt man: Wie ordne ich das ein? Kommentiere ich es? Bislang sind wir über die Lokalzeitung oder in Sitzungen darauf eingegangen, haben also den Kanal gewechselt – was Herr Schweiger ja nicht so empfiehlt.
Themenrückblick der vergangenen Symposien
Wie Kommunikation mit dem vernetzten Bürger gelingt
Die Sozialen Medien spielen in der Kommunikation eine besondere Rolle. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob die öffentliche Verwaltung in den Sozialen Medien vertreten ist, sondern wie. So das Ergebnis des diesjährigen Symposiums des Staatsanzeigers „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung“.
Wie kann Kommunikation mit dem vernetzten Bürger von heute gelingen? Welche Chancen und Möglichkeiten eröffnen die Sozialen Medien der Öffentlichen Verwaltung? Dieser Frage gingen über 160 Teilnehmer des ausgebuchten Staatsanzeiger Symposiums am vergangenen Montag in der IHK Stuttgart nach.
Breda Nußbaum, Chefredakteurin des Staatsanzeigers, stellt fest, dass „wir alle, die mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit befasst sind oder in der – zumindest kommunalen – Öffentlichkeit stehen, gar nicht mehr anders können, als uns mit den Sozialen Medien zu befassen.“ Auf dem Symposium vor fünf Jahren habe man sich noch die Frage gestellt, ob es Risiken oder Chancen für die öffentliche Verwaltung in den Sozialen Medien gebe. Heute ginge es nicht mehr darum, ob man die Sozialen Medien nutze, sondern nur noch darum, wie man dort seine Position vertreten könne.
Für die Positionen gelten allerdings rechtliche Rahmenbedingungen, die Carsten Ulbricht, der sich als Rechtsanwalt auf das Internetrecht spezialisiert hat, im Impulsvortrag darlegte. „Ich möchte keine Panik schüren, sondern Ihnen ein Gefühl geben für rechtliche Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild und Arbeitsrecht.“ Er gab den Teilnehmern praktische Tipps und den Hinweis, sich den 25. Mai diesen Jahres vorzumerken.
Denn dann tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft und damit strengere Anforderungen in Bezug auf den Datenschutz. Ulbricht empfiehl einen Handlungsrahmen für die Benutzung von Sozialen Medien durch öffentliche Stellen und machte aufmerksam auf ihre Vorbildfunktion. Dass über letzteres kontrovers diskutiert werden kann, zeigt Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, in seinem Vortrag. Palmer, der immer wieder mit seinen Einträgen auf Facebook für Aufsehen sorgt, stellt zu Beginn klar, dass seine Seite ihm als öffentliche Person gehört.
Den vollständigen Bericht lesen Sie in der Ausgabe 8 des Staatsanzeigers auf Seite 8.

Verena Fürgut, Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, Stadt Biberach/Riß
Ich finde es war ein sehr interessantes und aber auch gegensätzliches Symposium. Man hat viele unterschiedliche Stellungnahmen gehört: die rechtliche Seite, und das, was in der Praxis tatsächlich funktioniert. Wir haben festgestellt, dass wir schon vieles richtig machen, manches muss man vielleicht noch anpassen. Was für mich aber sehr deutlich wurde, ist der Spalt zwischen dem Legalen im Datenschutz und in der Praxis.

Uwe Seibold, Bürgermeister, Gemeinde Kirchheim am Neckar
Ich fand es sehr interessant, gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen, die Sichtweisen und die rechtlichen Fallstricke die es gibt, die mir teilweise so in der Form noch nicht bewusst waren. Ich denke insgesamt ist es ein Feld, das man beackern sollte und muss, weil das einfach zur heutigen Zeit dazugehört, gerade wenn man die jüngere Bevölkerungsschicht anders nicht mehr erreicht. Wir sind eine kleinere Kommune mit ca. 6.000 Einwohnern und es ist eine gewisse Herausforderung, das dann auch tagesaktuell zu machen. Bisher haben wir nur die eigene Internetseite um zu informieren.

Jonas Goldau, Assistent des Oberbürgermeisters, Stadt Überlingen
Heute gab es für mich sehr viele Highlights. Ich kannte Herr Palmer nur aus den Nachrichten, fand es aber wahnsinnig interessant, ihn live zu erleben und wie er sich heute gibt. Ich kannte ihn nur als sehr kontrovers, da er immer mit Vollgas postet. Das zweite Highlight waren die Informationen zu den rechtlichen Hintergründen, da es hier viel zu beachten gibt. Ich nehme heute auf jeden Fall eine Menge mit. Die Stadt Überlingen hat keine eigene städtische Facebook-Seite, möchte aber gerne eine. Lediglich der Bürgermeister ist privat auf Facebook.

Ina Klein, Stellvertretende Pressesprecherin, Stadt Bietigheim-Bissingen
Ich habe heute mitgenommen, dass unsere Stadt schon sehr gut aufgestellt ist in Sachen Social-Media. Zum anderen gab es auch immer wieder Informationen, wie unsere Stadt ihre Auftritte verbessern kann und neue Informationen, wie man seine Kanäle besser aufstellen kann. Eine der wichtigsten Erfahrungen heute war die Entwicklung in Richtung WhatsApp: Was man da alles machen kann und wie. Die Veranstaltung war supergut organisiert. Sie ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen im Jahr. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, besuche ich das Symposium des Staatsanzeigers immer wieder.

Stephanie Meyer, Büroleiterin des Oberbürgermeisters, Stadt Waldshut-Tiengen
Vor allem die Diskussion über einen städtischen Facebook-Kanal im Vergleich zu einem Kanal des Oberbürgermeisters war ein Thema, das für mich interessant war. Bisher sind wir nur auf Facebook. Die Resonanz ist da noch nicht so groß, eher 15 bis 20 „Likes“, das habe ich auch schon von anderen hier gehört, denen es da ähnlich geht. Ich besuche heute noch das Fachforum „Basiswissen“ und das zu Facebook. Bisher finde ich es megainteressant. Das sind hier alles neue Einblicke für mich.

Jochen Winkler, Bürgermeister, Gemeinde Neckarwestheim
Ich will mir einen Überblick darüber verschaffen, was gemacht und was empfohlen wird, um da einzusteigen. Ich poste ab und zu mal etwas, aber sehr rudimentär. Für mich ist es ein wichtiges Thema, denn einen Teil der Bevölkerung bekomme ich über das alteingesessene Amtsblatt nicht mehr. Wenn man da nicht dranbleibt wird die Gruppe, die man gar nicht mehr erreicht, immer größer. Und ich denke, wenn man es macht, soll man es gleich richtig machen. Nun möchte ich mich informieren, auf was man aufpassen muss, wo es rechtliche Hemmnisse gibt und wie man am besten anfängt.
Wie man komplexe Inhalte verständlich vermittelt, dieser Frage gingen die Teilnehmer des Symposiums Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung am 27. April 2017 nach. Breda Nußbaum, Chefredakteurin des Staatsanzeigers wies zu Beginn darauf hin, dass es „auch und gerade im schnelllebigen digitalen Informations- und Erregungszeitalter darauf ankommt, mit Sprache sehr sorgfältig umzugehen und die Wörter so zu wählen, dass wir uns deren Wirkung bewusst sind“. Die Verwaltung sei regelmäßig herausgefordert, schwer verständliche Gesetze, Verordnungen, Bescheide oder seitenlange Beschlüsse in Texte zu fassen, die der Normalbürger versteht. „Wie wir Pressesprecher und Journalisten kommunizieren, mit welchen Formulierungen und in welcher Sprache wir Botschaften verbreiten, trägt entscheidend dazu bei, was diese Botschaft beim Empfänger auslöst.“
Dass dies für sämtliches Handeln der Verwaltung gilt, machte der Verständlichkeits-Forscher, Frank Brettschneider im Impulsreferat deutlich: „Bescheide darf man nicht unterschätzen, sie haben eine kommunikative Wirkung“, sagte der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Bürger wollten heute verstehen, was vorgehe. Aus Verstehen folge Akzeptanz. Durch Studien wisse man, dass Journalisten bei Pressemitteilungen innerhalb weniger Sekunden und anhand weniger Merkmale entscheiden, ob Ihnen der Text einen Artikel wert ist oder nicht. Eines dieser Kriterien sei, ob sie die Mitteilung verstünden.
Dass dahinter sogar ein knallharter Kostenfaktor steckt, erläuterte Brettschneider an zwei Beispielen: Für eine Versicherung und eine Krankenkasse hatten seine Forscher die Schreiben an Kunden und Versicherte sprachlich optimiert. Je die Hälfte der Kunden erhielt die ursprünglichen und die leicht verständlichen Schreiben. Letztere führten dazu, dass 30 Prozent weniger Kunden anriefen und nachfragten, weil sie etwas nicht verstanden hatten. Deshalb gab Brettschneider praktische Tipps: „Die Englischkenntnisse der Deutschen werden grandios überschätzt“ – also keine Anglizismen. Sätze sollten nicht mehr als zwölf Wörter enthalten, lange Wörter mit Bindestrich verbunden werden. „Aktiv statt passiv, bildhaft und anschaulich.“
Das haben unsere Besucher über das Symposium 2017 gesagt.
Christiane Conzen, Pressereferentin, Städtetag Baden-Württemberg
Im Fachforum „Zahlen, Daten, Grafiken“ habe ich viele nützliche und gut umsetzbare Tipps für den Umgang mit Zahlen aller Art bekommen. Ich werde in nächster Zeit vor allem Grafiken mit ganz anderen Augen sehen. Was Herr Sommer im Fachforum „Wie man Kompliziertes einfach sagt“ dargestellt hat, war nicht neu. Aber das noch einmal strukturiert dargestellt zu bekommen, war hilfreich: Die Systematik, nach der man vorgehen kann, werde ich mir jetzt gut sichtbar am Arbeitsplatz aufhängen.

Markus Klohr, Pressesprecher, Stadt Bretten
Ich finde das Symposium sehr positiv, insbesondere den Austausch mit den für mich neuen Kollegen. Das alles ist eine neue Perspektive für mich, da ich erst vor Kurzem vom Journalismus in die Pressearbeit gewechselt habe. Es könnte hier und da noch konkreter sein, zum Beispiel die Diskussion mit dem Minister, wo die wirklich heiklen Fragen gekonnt umschifft wurden. Mich interessiert konkret das Klartext-Siegel von Professor Brettschneider. Vergibt er das auch? Das werde ich ihn demnächst mal fragen, denn damit könnte man seine Pressemitteilungen aufpeppen. Zum Thema Bürgerbeteiligung nehme ich einige Ideen mit, wo Fallstricke lauern.

Gabriele Maurer, Stadt Ludwigsburg, Fachbereich Bildung und Familie
Zwar kenne ich schon viele Aspekte, aber hier bekommt man Impulse zur Auffrischung oder wie man es noch besser machen könnte. Gut finde ich, dass das Thema so anschaulich und unterhaltsam erklärt wird. Ich organisiere in Ludwigsburg auch die Kinder-Uni. Dort haben wir für eine Exkursion in ein Einkaufszentrum von der Managerin neulich einen Text bekommen, in dem das Wort „Refurbishment“ (Sanierung) vorkam. Ich habe dann die Verfasserin gebeten, doch daran zu denken, dass wir eine Kinder-Uni sind und die Eltern uns darauf hinweisen, dass wir kindgerechte Texte verwenden sollen. Die Kollegen wissen aber schon, wir wir schreiben sollen.

Bernd Killinger, Pressesprecher, Stadt Bruchsal
Ich war bis jetzt im Fachforum Bürgerbeteiligung und nehme mit, dass es ein wichtiges Thema ist, dass es aber auch einen gewissen Diskussionsbedarf gibt, wie man Bürgerbeteiligung gut gestaltet. Das Thema Vernetzung ist hier beim Symposium sehr gut umgesetzt. Ich finde es super, dass es diese Möglichkeit gibt. Am Ende arbeiten wir alle hier an denselben Themen, haben aber unterschiedliche Herangehensweisen und hier gibt es viele Best-Practice-Beispiele. Es ist interessant, hier mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ins Gespräch zu kommen. Das hilft, über den Tellerrand zu blicken.

Nadine Herwerth-Gajer, Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinde Offenau
Ich bin Wiederholungstäterin, ich bin bestimmt schon zum fünften Mal dabei. Irgendwas nimmt man jedes Mal mit – nicht die große Erleuchtung, aber einen Aspekt, der einem so nicht bekannt oder bewusst war. Es sind hier vorzugsweise Vertreter von Behörden da, die nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen, gerade wir kleinen Kommunen sollten bei den Themen nicht hinten runter fallen. Wir haben 2700 Einwohner, aber auch wir müssen Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung machen, auch wir müssen Änderungen umsetzen, zum Beispiel beim Redaktionsstatut für die Amtsblätter.

Achim Eickhoff, Pressesprecher, Stadt Singen
Ich arbeite noch nicht so lange in der Verwaltung, daher habe ich mir vor allem Tipps erhofft, „wie sage ich es meinem Kinde“ – sprich dem Bürger. Danach habe ich mir meine Workshops ausgesucht. Ich nehme mir immer vor, verständliche Sprache zu verwenden, aber oft erliege ich dann doch den Wünschen der Fachkollegen. Es ist schön, dass dieses Symposium bewusst darauf aufmerksam macht: Denk dran, einfache Sprache! Beeindruckt hat mich der Vortrag von Herrn Brettschneider, der sich mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigt, es aber es auch gut vermitteln kann.
Beim Symposium für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für öffentliche Verwaltung am 11. April 2016 ging es um leserfreundliche und zielgruppengerechte Kommunikation - auch im Krisenfall. Wodurch sich professionelle Kommunikation in Alltag und Krise auszeichnet, unter diese Leitfrage hatte der Staatsanzeiger am 11. April 2016 sein Symposium Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung gestellt. „In mancher Hinsicht ist der Ton rauer geworden, Reaktionen fallen heftiger aus auf Dinge, die der Urheber zunächst vielleicht in seiner Bedeutung unterschätzt hat“, stellte die Chefredakteurin Breda Nußbaum in ihrer Begrüßung fest. Volle Aufmerksamkeit und solides Wissen seien daher heute in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Wie man Krisen kommunikativ meistern kann, darauf ging der Ministerialdirektor im Integrationsministerium und frühere Landespolizeipräsident Wolf-Dietrich Hammann im Impulsvortrag ein.
Wie können Pressesprecher ihre Arbeit so ausrichten, dass sie zu einem positiven Image von Verwaltungen beitragen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Symposiums Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatsanzeigers diese Woche in Stuttgart. Eine Erkenntnis: Konkret kommunizieren und erlebbar sein.
Dass Pressesprecher heute in vielen Feldern aktiv sein müssen, darauf wies Breda Nußbaum, Chefredakteurin des Staatsanzeigers in ihrer Begrüßung hin: „Sie sollen verschiedene Zielgruppen passgenau informieren, Sie sollen Identifikation schaffen mit der Institution, die Sie vertreten und Sie sollen damit zu einem möglichst positiven Image dieser Institution beitragen.“ Impulse für diese Arbeit sollte das Symposium mit seinen Fachforen geben.
Warum Pressesprecher ihren Teil zum Image einer Verwaltung beitragen, machte der Markenberater Bernhard Klein im Impulsreferat deutlich: „Eine Stadt ist eine Marke – ob sie will, oder nicht. Die Frage ist, ob sie sie nutzt oder brach liegen lässt.“ Eine erfolgreiche Marke sei letztlich nichts anderes als ein positiv besetztes Vorurteil. Wie man dies erreicht, dazu gab Klein Tipps.
Wie eine Ein-Mann-Kapelle sollen Pressesprecher in der Verwaltung einen Takt vorgeben, aber nach den Noten ihres Dienstherrn spielen und damit einen Hit landen. Wie das leistbar ist, diskutierten 130 Teilnehmer am Montag, den 12. Mai 2014, beim Symposium Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatsanzeigers.
„Kommunizieren, organisieren, moderieren – vom Pressesprecher zum Medienmanager“, mit diesem Titel hatte der Staatsanzeiger bereits benannt, vor welcher Vielfalt an Aufgaben Pressesprecher in der Verwaltung stehen. „Auch die öffentliche Verwaltung bedient zahlreiche Medienkanäle mit eigenen Inhalten“, stellte die Chefredakteurin des Staatsanzeigers, Breda Nußbaum, in ihrer Begrüßung der 130 Teilnehmer fest. „Diese müssen ansprechend aufbereitet sein, will man seine Zielgruppe erreichen.“
Den vollständigen Bericht lesen Sie in der Ausgabe 19 des Staatsanzeigers.
Soziale Medien können ein Gewinn im direkten Kontakt der öffentlichen Verwaltungen mit Bürgern sein. Doch je nach Netzwerk bereitet der Umgang Probleme. Welche, darüber diskutierten am Dienstag Politiker und Datenschützer beim Symposium Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatsanzeigers.
„Wie und wo kann ein Auftritt in den Sozialen Medien funktionieren?“, stellte die Chefredakteurin des Staatsanzeigers, Breda Nußbaum, als Gastgeberin die Grundfrage für die öffentlichen Verwaltungen im Land. Thomas Döbler, Professor an der Macromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in Stuttgart gab im Impulsreferat Antworten: „Ein reichliches Drittel der Nutzer geht mindestens einmal pro Woche ins Netzwerk.“ Da könne ein Auftritt sinnvoll sein, wenn man ihn richtig aufziehe.
„Es ist unbestritten, dass Social Media unser Verhalten, wie wir miteinander kommunizieren, verändert“, erklärte Döbler. „Nicht nur zum Guten.“ Die negativen Seiten führte er anhand der teils wüsten Kommentare auf Facebook-Seiten mehrerer Politiker vor. „Das sind unkontrollierbare Aspekte in Social Media, denen Verwaltungen und Politik begegnen müssen.“ Hinzu kämen ein hoher Zeitaufwand, um die Seiten zu überwachen, sowie die häufigen technischen Änderungen der Anbieter. Der Nutzen bleibe im Ungefähren: „Ob man mit Social Media wirklich Image beeinflussen kann, ist noch nicht ganz klar.“Welche Chancen und Bedenken die Verwaltungen umtreiben, zeigte die von Isabel Kling, Sprecherin der CDU-Fraktion, moderierte Podiumsdiskussion.
Auf der Straße respektiert, im Internet angefeindet
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ist auf Facebook aktiv: „Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass ich in meiner Stadt eine Respektsperson bin, solange ich auf der Straße unterwegs bin. Im Internet nicht. Dort wird der Ton sehr rau“, so Palmer. Doch Palmer sieht auch Vorteile der Sozialen Netzwerke: Von Problemen der Bürger habe er über Kommentare erfahren, die sonst nicht zu ihm durchdrangen.
Keine Anfeindungen erlebt hat der Bürgermeister der Gemeinde Hemmingen (Kreis Ludwigsburg), Thomas Schäfer (CDU). Warum er die Sozialen Netzwerke bedient: „Es gibt die Diskussionen auch, wenn sich die Gemeinde nicht präsentiert.“ Deshalb klinkt er sich gelegentlich in die Facebook-Gruppe von Bürgern ein, die nichts mit der offiziellen Gemeindeseite zu tun hat.
Chefredakteurin Breda Nußbaum hat in ihren Seminaren für Bürgermeister zu Sozialen Medien beobachtet, dass 95 Prozent kritisch eingestellt sind, vor allem weil sie das Personal dafür nicht haben.
Zusätzliche Möglichkeit, um mehr Menschen zu erreichen
Die zusätzliche Reichweite ist für Tilo Berner (Grüne) das ausschlaggebende Argument für eine Präsenz in sozialen Netzwerken. Er verantwortet im Staatsministerium die Auftritte des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). „Es gibt Menschen, die würden nie auf eine Homepage der Landesregierung gehen“, so Berner.
Die Polizei nutzt Soziale Medien lediglich bei Großeinsätzen, wie der Landespolizeipräsident Wolf Hammann erklärte. Zwar sei Transparenz oberstes Ziel, aber: „Es wäre für uns schwer erträglich, wenn wir rassistische oder strafbare Inhalte auf der Polizeiseite finden würden, die wir nicht sofort löschen könnten.“
Der Landesdatenschutzbeauftragte Jörg Klingbeil machte klar: „Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden.“ Die Rechtslage sei aber bei außereuropäischen Anbietern so unklar, dass er von einer Nutzung abriet. „Eine öffentliche Einrichtung ist nicht dazu da, dass ein Unternehmen wie Facebook mit den Daten der Nutzer Geld macht“, sagte Klingbeil, selbst wenn es den meisten Nutzern bewusst sei, „dass Facebook kostenlos ist, weil sie selbst die Ware sind.“
Vor knapp zwei Jahren war das Vertrauen von Wolfgang Drexler (SPD) in die Medien an einem Tiefpunkt angelangt. Damals war der heutige Vize-Präsident des baden-württembergischen Landtags Sprecher des Bahnprojekts S?21 gewesen und tief in die Grabenkämpfe zwischen Bahnhofsgegnern und Bahnhofsbefürwortern verwickelt. „Ich hatte das Gefühl, dass die Journalisten in einer Art Kampagnenjournalismus ihre vorgefertigte Meinung vertreten und sie auf gegenteilige Äußerungen nur lauern“, sagte Drexler auf dem Symposium, das die Redaktion des Staatsanzeigers am Montag für rund 150 Vertreter der öffentlichen Verwaltung, vor allem Bürgermeister und Pressesprecher, veranstaltete.
„Viele Journalisten haben offen den Konflikt gesucht, anstatt sich auf die Fakten zu konzentrieren. Auch bei der Themengewichtung sah Drexler Probleme: „Es wurden die trivialsten Dinge zu S?21 ausgegraben wie etwa Yoga-Kurse gegen den Bahnhof und groß in die Zeitung gebracht“, berichtete Drexler und schüttelte dabei den Kopf.
Transparenz und Ehrlichkeit in Krisensituationen
Ganz anderer Meinung war Simone Kaiser. „Wir Journalisten denken in erster Linie an unsere Leser und da kann so eine Reportage durchaus sehr spannend sein“, sagte die Spiegel-Korrespondentin aus Frankfurt. Auch Uwe Ralf Heer, Chefredakteur der Heilbronner Stimme, wehrte sich gegen Drexlers Behauptungen: „Für Sie mag das trivial sein, aber für den Leser ist es hochspannend.“ Auch den Vorwurf des Kampagnenjournalismus wehrte Heer ab. „Guter Journalismus ist immer kritisch und niemals voreingenommen.“ Aber nicht alle Diskussionsteilnehmer haben schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht. „Ich bin für Transparenz in unserer Öffentlichkeitsarbeit“, sagte Innenminister Reinhold Gall (SPD). Hintergrundgespräche mit Journalisten wären bei heiklen Themen oft der bessere Weg, so Gall. Für Jürgen Bäuerle (CDU), Landrat des Landkreises Rastatt, ist eine gezielte und schnelle Information die beste Lösung. „In Krisensituationen ist es sinnvoll, sofort die Medien zu informieren.“ Günther Petry (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Kehl, pflichtete ihm bei: „Ehrlichkeit im Umgang mit der Presse ist das Wichtigste, genauso erwarten wir das aber auch von der Presse selbst“, sagte er. Bäuerle sprach sich für eine professionelle Presseabteilung aus. „Auf diese Leute kann ich mich verlassen.“ Dem stimmte Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Hohenheim, zu: „Politiker und Verwaltungen haben eine schwer verständliche Sprache, mit guter Pressearbeit lässt sich das beheben.“
Ängste abbauen und Herausforderungen annehmen
Die Chefredakteurin des Staatsanzeigers, Breda Nußbaum, sieht in einer professionellen Pressearbeit große Chancen für Städte und Kommunen. „Ein zielgerechter Umgang mit den Medien kann für die Verwaltung nur von Vorteil sein.“ Es gebe zwar noch immer Ängste beim Umgang mit den Medien, diese ließen sich aber abbauen, wenn man sich auf sein Gegenüber einlasse. In vielen Kommunen hat sich diese Sichtweise schon durchgesetzt. Die Entwicklung hin zu einer Mediengesellschaft stellt die Verwaltung vor große Herausforderungen, birgt aber auch viele Chancen, die es zu nutzen gilt, so Nußbaum.
Bernhard Fritz, seit 1994 Oberbürgermeister von Winnenden, verschaffte der Amoklauf an der Albertville-Realschule ungewollt tiefe Einblicke in die Krisenkommunikation mit den Medien. „Nach dem Amoklauf waren binnen kurzer Zeit 25 unterschiedliche Fernsehanstalten aus halb Europa vor Ort“, berichtete er auf dem Symposium, das die Redaktion des Staatsanzeigers am Montag für rund 120 Vertreter der öffentlichen Verwaltung, vor allem Bürgermeister und Pressesprecher, veranstaltete.
Alle Journalisten hätten Ansprüche an seine Stadtverwaltung herangetragen, so Fritz. Es habe zwei Tage gedauert, bis man alles im Griff hatte. Fritz beklagte auch Schwierigkeiten mit den Medien. Es gebe drei Prozent der Journalisten, „die einem das Leben richtig schwer machen“, sagte er in Anspielung auf fragwürdige Recherchemethoden.
Reißerische Überschriften, fragwürdige Fotomontagen
„Der Presserat habe nach Winnenden Rügen ausgesprochen“, berichtet Jörg Blumenthal, Leiter des Fachbereichs Rats- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Mannheim sowie Mitglied des Presseausschusses des Deutschen Städtetags. Reißerische Überschriften, fragwürdige Fotomontagen und pietätlose Grafiken beschäftigen seither das Organ der freiwilligen Selbstkontrolle der Medien. „Es ist allerhöchste Zeit, sich das genauer anzuschauen“, sagte Blumenthal. Er forderte eine „geistig- moralische Wende“ der Medien.
Krisensituationen sind in der Mediengesellschaft nach Ansicht der Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Mast „zur Normalität geworden und können jederzeit auftreten“. „Für alle Personen und Organisationen, die in der Öffentlichkeit agieren, stelle sich jedoch nicht die Frage, „ob eine Krise eintritt, sondern nur, wann und welche“.
Völlig unvermittelt traf Volkmar Weber - bis zum Februar 2009 Oberbürgermeister der Stadt Überlingen - der Zusammenprall zweier Flugzeuge über dem Bodensee im Juli 2002. „Um Mitternacht ist das Unglück passiert. Kurz danach waren bereits rund 100 Medienvertreter vor Ort“, erinnerte er sich. Um vier Uhr dreißig in der Nacht habe man die erste Presseinformation rausgegeben. „Mit Krisen muss man leben lernen“, findet Weber. „Die können über einen hereinbrechen.“
Dann aber müssen Vertreter der öffentlichen Verwaltung meist völlig unvorbereitet mit den Medien umgehen. Mißtrauen und Angst vor Reportern, die keine Grenzen kennen, ist nicht unbegründet. Ulrich Damm, Autor und Journalist aus München, findet zwar: „Behörden müssen generell keine Angst vor Reportern haben“. Ein gewisser Respekt vor den Boulevardzeitungen und dem Fernsehen sei jedoch angebracht. Amtsträger sollten die Wirkungsmechanismen von Medien kennen.
Öffentliche Stellen müssen journalistischer denken
Die Chefredakteurin des Staatsanzeigers, Breda Nußbaum, wies darauf hin, dass sich „Journalisten und Vertreter der öffentlichen Verwaltung oft nicht verstehen“. „Sie lassen sich zu wenig aufeinander ein“, sagte sie. Es gebe zudem Misstrauen auf beiden Seiten. Nußbaum forderte von den öffentlichen Stellen, sich besser auf die Medien einzustellen: „Die Verantwortlichen müssen journalistischer denken. Medien ticken ganz anders als die Verwaltung denkt. Sie brauchen Informationen schnell, knapp und mediengerecht“, sagte Nußbaum.
Der Chefredakteur der Heilbronner Stimme, Uwe Ralf Heer, forderte, dass die öffentliche Verwaltung in Sachen „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genauso geschult werden müsse wie in anderen Dingen auch. Es sei nötig, dass die Behörden offensiv mit Nachrichten umgingen. Mauern sei keine Alternative.
„Man muss sich die Medienvertreter zu Partnern machen“, empfahl der Winnender OB Fritz. Selbst heute, nach über sechs Monaten nach den Ereignissen in Winnenden, hält man dort immer noch regelmäßig Pressekonferenzen ab. „Inzwischen kennen sich die Beteiligten. Man könne sich gegenseitig vertrauen, sagt Fritz.
Kontakt
 Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?Akademie
Telefon: 07 11.6 66 01-983
Telefax: 07 11.6 66 01-34
E-Mail senden
Newsletter
Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!
Unsere Partner

Vernetzt mit dem Staatsanzeiger

Werden Sie unser Fan auf Facebook und profitieren Sie von unseren Aktionen.