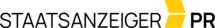Die tödliche Grippe-Epidemie des Jahres 1918 traf eine bereits schwer kriegsgeschädigte Gesellschaft
Die politischen Ereignisse von 1918 sind bekannt. Doch Stellungskrieg, Kapitulation und Revolution wurden getragen von körperlich schwer beeinträchtigten Personen. Ein großer Teil der Gesellschaft ging ausgezehrt, krank und verstümmelt in die neue Demokratie.

Für die Zivilbevölkerung war auch das letzte Kriegsjahr unverändert bestimmt durch den täglichen Kampf um Nahrungsmittel, durch Hunger, durch hohe Frauen- und Kindersterblichkeit, aber auch durch eine deutliche Zunahme der Tuberkulose. Hinzu kam im Frühjahr 1918 eine verheerende Grippewelle. Die „Spanische Grippe“ war zwar nicht kriegsentscheidend, schwächte aber die Kräfte der Bevölkerung noch weiter. Hunger, Tuberkulose und Grippe waren zweifellos verantwortlich für die überdurchschnittliche Sterblichkeit der deutschen Zivilbevölkerung besonders von Frühjahr bis November 1918.
Besonders dramatisch war die Lage der arbeitenden Frauen. Von Ende Oktober 1917 bis Ende Oktober 1918 erhob die „Gruppe Frauenarbeit“ des württembergischen Kriegsministeriums in einer Enquete-Studie die „Lage der handarbeitenden Frauen in den kriegswichtigen Arbeitszweigen des Landes“. Die Landwirtschaftsarbeit war hier allerdings ausgeklammert geblieben. Damalige Hilfsreferentin der Arbeitsgruppe war die 1893 geborene Staatswissenschaftlerin Clara Henriques, als Jüdin am 19. Oktober 1942 nahe Riga ermordet. Mit der Auswertung der erfassten Daten war sie bis weit über das Kriegsende 1918 hinaus beschäftigt. Ende 1920 reichte Henriques die Ergebnisse dieser Erhebung an der Universität Tübingen als Dissertation ein; sie trug den Titel „Die Lage der arbeitenden Frauen in den kriegswichtigen Arbeitszweigen Württembergs – Eine vom Württembergischen Kriegsministerium 1917/18 veranstaltete Erhebung“. Clara Henriques zeigte in ihrer Studie, wie sehr gerade die Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie Württembergs gesundheitlich unter der extremen körperlichen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft gelitten hatten. Insbesondere unter den älteren
Arbeitnehmerinnen über 40 Jahren hatten – gegenüber dem Landesdurchschnitt von 21% über alle Altersgruppen – mehr als 50% als „kränklich“ bezeichnet werden müssen. Besonders in der schadstoffreichen Zünderfabrikation und in der körperlich fordernden Militärbekleidungsindustrie wurden „kränkliche und schwächliche“ Frauen zu mehr als 25% gemeldet. Bei den chronischen Krankheiten war es vor allem die zum Teil in schweren Formen verlaufende Tuberkulose, unter der immerhin 2,75% der Arbeiterinnen litten.
Die Höhe der deutschen Zivilverluste aufgrund der Hungerblockade der Entente- Mächte wurde in der Nachkriegspropaganda allerdings stark übertrieben, um eine Minderung der Reparationsleistungen zu erreichen. Detaillierte Analysen des Statistischen Reichsamtes lassen nach Abzug der grippebedingten überdurchschnittlichen Sterblichkeit des letzten Kriegsjahres den Schluss zu, dass die Gesamtzahl der zivilen Hungertoten „nur“ bei etwa 424.000 lag. Katastrophal war die Situation gleichwohl. Der Grippe erlagen in Deutschland 1918 etwa 300.000 Menschen. Wo die verheerende Influenza des letzten Kriegsjahres 1918 wirklich ausgebrochen ist, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Sicher scheint inzwischen zu sein, dass diese große Grippewelle mit amerikanischen Schiffen, überwiegend Truppentransportern, im Frühjahr 1918 Europa erreichte. Erste Nachrichten über sie trafen aus Spanien ein, was ihr den Namen gab.

Zeitschrift „Simplizissimus“, Heft 29 vom 15. Oktober 1918. „Ich sehe es kommen: ehe ich
nicht eingreife, wird die Welt von ihrem Wahnsinn nicht kuriert.“
Grippe und Vergnügungssucht
Als die erste Grippewelle des Jahres 1918 die hart umkämpften Fronten im Westen und Deutschland erreichte, gab es zunächst wenig Anlass, dieser normal erscheinenden Erkältungskrankheit größere Bedeutung beizumessen. Der Reichsgesundheitsrat beschäftigte sich zwar in seiner Sitzung vom 10. Juli 1918 mit der „Influenza“, hielt aber die durch das Reichsseuchengesetz von 1900 eröffneten Bekämpfungsmöglichkeiten für hinreichend und ein koordiniertes Vorgehen in Abstimmung mit den Bundesstaaten für möglich. In der Presse las man wenig über die Sitzung des Reichsgesundheitsrates. Allgemein hielt man die Krankheit für abklingend. Sie würde in der warmen Sommerwitterung bald verschwinden, dachte man. Doch das war falsch. Die zweite, jetzt äußerst vehemente und oft von Lungenentzündungen begleitete Variante verlief im Herbst dramatisch und lieferte ab Oktober 1918 durchaus Anlass zur Besorgnis. Am 16. Oktober 1918 trat der Reichsgesundheitsrat erneut zusammen, nun auf direkte Initiative des selbst erkrankten Reichskanzlers Max von Baden. Einer mehrstündigen Beratung der Krise folgten aber keine konkreten Vorschläge.
Bis die zensierte Zusammenfassung dieser Influenza-Sitzung des Reichsgesundheitsrates die Presse aller Regionen des Reichs erreicht hatte, war der Krieg vorüber und die Novemberrevolution in vollem Gang. Dem revolutionären „Rat der Volksbeauftragten“ war die Grippe egal. Bei den Ärzten herrschte Erklärungsnotstand, in der Öffentlichkeit Angst. Vor diesem Hintergrund entstand ein neuer gesellschaftlicher Umgang mit der Seuche. Teile der Bevölkerung flüchteten als Reaktion auf die tödliche Bedrohung ins Vergnügen. Gegen Ende des Weltkriegs schossen in den größeren Städten des Kaiserreichs Lichtspieltheater wie Pilze aus dem Boden. Auch Tanzvergnügen waren – selbst an stillen Feiertagen – an der Tagesordnung. Typisch dafür ist vielleicht ein Artikel, der am 9. November 1918 in den „Konstanzer Nachrichten“ erschien und noch gar nichts mit dem Ausgang des Krieges und dem Beginn der Novemberrevolution zu tun hatte. Es ging um ein Tanzvergnügen am gerade zurückliegenden Totensonntag in der Industriestadt Singen: „Im Nebenzimmer einer hiesigen Wirtschaft wurde am Sonntagabend ein Tanzvergnügen (!) durch die Schutzmannschaft gestört; etwa 40–50 Personen, unter ihnen halbwüchsige Burschen, Mädchen und sogar Kriegerfrauen, deren Männer im Felde stehen, tanzten nach den Weisen einer Ziehharmonika trotz dem Ernste der Zeit, trotz Krieg, Elend, Epidemie und was heute sonst noch die Menschheit heimsucht. Auch der Seelensonntag störte die saubere Gesellschaft nicht.“

konservative Mediävist von 1914 bis 1919 führte, ist inzwischen ediert und eine interessante Quelle zur Sozial- und Alltagsgeschichte des Ersten Weltkriegs.

Vergnügen statt Vorsorge
Die jungen Leute waren im November 1918 ganz eigenen Vorstellungen vom Feiern gefolgt. Die Grippe tobte, aber der Krieg war so gut wie zu Ende. Während der Tod auch im Südwesten des Kaiserreichs dabei war, reiche Grippe-Ernte einzufahren, hatten sich die Singener Jugendlichen einfach nur ausgelassen vergnügt. Es war nicht ungewöhnlich, dass Tanz-, Kino- und Theatervergnügen ein Ausmaß angenommen hatten, das so gar nicht zum Ernst der Lage passen wollte. Bereits am 24. Oktober hatte der Konstanzer Stadtrat erfolglos versucht, das Stadttheater und die Kinos der Stadt zu schließen und auch alle „übrigen Veranstaltungen“ wegen der Grippe-Epidemie absagen zu lassen. Das Bezirksamt hatte diesen Antrag abgelehnt und folgte damit einer Entscheidung des badischen Innenministeriums, das seinerseits Theater und Kinos offen halten wollte, um die Stimmung in der Bevölkerung nicht weiter zu verschlechtern.
Dieser Trend wurde in konservativen Kreisen des Kaiserreichs mit Besorgnis gesehen. Man hielt ihn für unangebracht, wie aus einer Tagebuchnotiz des Heidelberger Mediävisten Karl Hampe vom 27. September 1918 hervorgeht. Es müsse dem „Volke“, so Hampe, endlich „der Ernst der Lage gesagt“ und „dieser Einlullungsnebel von Zerstreuung und Schönfärberei entfernt werden“. Dass man angesichts der sich anbahnenden Grippekatastrophe und der bedrohlichen politischen und militärischen Situation im fünften Kriegsjahr nach Zerstreuung suchte, war durchaus verständlich und folgte einem reichsweiten Trend. Im April 1913 schon hatten in Berlin 206 Lichtspielhäuser insgesamt annähernd 50.000 Zuschauerplätze bereitgestellt.
In der Provinz sah es ähnlich aus. So standen in Mannheim 1918 bereits einige Tausend Theaterund Kinoplätze zur Verfügung, die trotz Krieg und Grippe nicht leer blieben. Im „Neuen Theater“ am Rosengarten wurde am 13. Juni 1918 Strindbergs „Kameraden“ vor vollem Haus gegeben; im Nationaltheater liefen zur gleichen Zeit Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“, Kleists „Zerbrochener Krug“ und bezeichnenderweise Wagners „Götterdämmerung“. Anfang Oktober 1918, auf dem Höhepunkt der Grippewelle, flimmerte im „Colosseum“ mit 800 Sitzplätzen der Streifen „Memoiren des Satans“, und parallel dazu dirigierte Emil Reinfurth im Nibelungensaal des Rosengartens das opulente Singspiel „Im deutschen Feldlager vor 300 Jahren“ mit
über 300 Mitwirkenden, darunter als Komparsen Unteroffiziere, Mannschaften und Spielleute der Garnison Mannheim. In all diesen Sälen hustete und schniefte das fiebrige, aber begeisterte Publikum, und die Luft war viral geschwängert.

auch während der Grippe-Epidemie im Oktober 1918 regelmäßig Konzerte statt.
Vor dem Hintergrund solcher Lichtspielund Theatereuphorie beriet der Stadtrat Mannheims am 17. Oktober den Entscheid des Ortsgesundheitsrates, außer allen Mannheimer Schulen auch die Vergnügungsstätten der Stadt schließen zu lassen. Der Stadtrat wandte sich in dieser Frage zugleich ans Innenministerium in Karlsruhe. Dort revidierte man die Anordnung des Ortsgesundheitsrates sofort per Telegramm, denn es könne getrost „der Bevölkerung überlassen“ bleiben, „ihr Verhalten zu bestimmen“. Die Mannheimer „Gesellschaft der Aerzte“ war erbost und ließ am 21. Oktober im Generalanzeiger eine Notiz dazu schalten, in der es hieß: „Die Seuche hat in hohem Maße an Ausdehnung und Gefährlichkeit zugenommen. Die Aerzte sind an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die Krankenhäuser sind überfüllt, das Pflegepersonal in der unerhörtesten Weise überlastet, aber ruhig laden nach eintägiger Pause die Litfaßsäulen zum Besuch von allen möglichen Zusammenkünften ein, der besten Gelegenheit, die Epidemie weiterzuverbreiten.“

Doch was hätte ein Versammlungsverbot noch an der Verbreitung der Influenza ändern können? Und so blieben die „Vergnügungsstätten“ der Stadt ebenso geöffnet wie in München, Frankfurt, Berlin und an vielen anderen Orten. Daran änderte auch der Grippetod des 70-jährigen Direktors des Rosengartens, Heinrich Löwenhaupt, am 29. Oktober nichts. Im „Colosseum“ sah man stattdessen ab Anfang November den Film „Sturz der Menschheit“.
Die Betäubung der Depression konnte zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr recht gelingen. Kriegsniederlage und Zusammenbruch der jahrhundertealten monarchischen Ordnung waren Anfang November 1918 besiegelt, nicht zuletzt auch signalisiert durch den Sieg der Influenza. Und dass man sich in der letzten Kriegswoche ganz allgemein als „matt, fahl und sterbensmüde“ empfand (so der bereits erwähnte Heidelberger Historiker Karl Hampe), war nur wenig der Grippe geschuldet; es entsprach vor allem der allgemeinen mentalen Erschöpfung am Ende eines
fürchterlichen, einundfünfzig Monate währenden und nun erkennbar verlorenen Krieges. So notierte Hampe am 12. Oktober 1918 in sein Tagebuch: „Die Grippe führt jetzt hier zu schweren Verwickelungen; in der letzten Woche gab es sechzig Todesfälle!“, und ergänzte sogleich: „Die politischen Sorgen lassen mich nicht recht schlafen; sobald man einen Augenblick wacht, fällt es wie eine schwere Last auf einen.“
Aber auch die Gesunden traf die Grippe hart. Schmerzhaft war die Lähmung des Fern- und Nahverkehrs durch den krankheitsbedingten Ausfall von Eisen- und Straßenbahnführern oder Schaffnerinnen. Auch der Postverkehr brach tageweise zusammen, wie etwa in Heidelberg. Bekümmert notiert Karl Hampe am 6. November in seinem Tagebuch: „Besonders unangenehm ist in diesen Tagen, in denen sich die Ereignisse jagen, dass die ,Frankfurter Zeitung‘ gar nicht und die ,Badische‘ sehr unregelmäßig gebracht wird wegen Erkrankung der Trägerinnen.“ Katastrophal war die Lage in den Krankenhäusern, wo sich die schweren Fälle von grippaler Lungenentzündung häuften, das Pflegepersonal aber krankheitsbedingt ausfiel und das ärztliche Personal überwiegend zum Militärdienst verpflichtet war. In der deutschen Tagespresse las man zensurbedingt nur wenig vom Gipfel der Grippewelle im Oktober 1918, und in den Schulen gab es reichsweit „Grippe-Ferien“.
Indes, die Grippe war nur eines der bedrückenden Sozial- und Gesundheitsprobleme am Ende des Krieges. Die Bilanz des Völkerschlachtens war erschütternd. Konservativ geschätzt belief sich die Zahl der gefallenen und verstorbenen Soldaten im Reich auf mindestens 1,8 Millionen Männer. Hoch war der Blutzoll des Krieges auch in den südwestlichen Teilen des Deutschen Reiches. Fast jeder fünfte der 14.000 Kriegsteilnehmer aus Hohenzollern kehrte nicht zurück. Von den gut 250.000 Kriegsteilnehmern aus Württemberg fielen an die 83.000, und 63.000 Badener ließen ihr Leben an den Fronten des Krieges. Neben den Gefallenen und an Krankheit Verstorbenen bezifferte der verspätete (1934) und fehlerhafte Sanitätsbericht auch insgesamt 702.778 aus dem Heer als „dienstunbrauchbar“ Entlassene (davon 503.713 mit, 199.065 ohne Versorgung). Von der Gesamtzahl der „Dienstunbrauchbaren“ mit Versorgung wiederum waren 89.760 als „Verstümmelte“ mit Ansprüchen auf eine „Verstümmelungszulage“ anerkannt. Zu jener Gruppe gehörte der überwiegende Teil der schwer- und schwerstbeschädigten Kriegsinvaliden der Nachkriegszeit. Hinter dem Begriff „Verstümmelte“ verbargen sich 15.503 Arm- und 24.145 Beinamputierte sowie weitere 34.972, deren ein- oder beidseitige Funktionsstörung der oberen oder unteren Extremität einer Amputation gleichkam. Ihre Sprache hatten 230 verloren, ihr Gehör auf beiden Ohren 1.058, das Augenlicht beidseitig 1.445, einseitig 3.408. Als geisteskrank mit Versorgungsansprüchen wurden 3.955 und „wegen schwerer Gesundheitsstörungen“ mit Pflege- und Wartungsbedürftigkeit weitere 5.034 Soldaten entlassen. Es gibt gute Gründe, diese offiziellen Zahlen als geschönt anzuzweifeln. Neuere Hochrechnungen gehen von etwa 2,7 Millionen dauernd kriegsbeschädigten Soldaten aus, was etwa 11% der insgesamt 24,3 Millionen verletzten und schwerverletzten Soldaten entsprechen würde. Hinzu traten etwa 533.000 versorgungspflichtige Kriegswitwen und etwa 1,2 Millionen Kriegswaisen. Aus dem Krieg war ein unermessliches Elend und Leid entstanden, weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus. Es sollte die soziale Landschaft der Weimarer Republik bis in die Jahre der NS-Diktatur hinein prägen.
Bereits während des Krieges wurde das politische Potenzial der vielen Kriegsbeschädigten zu einem bedrohlichen Phänomen. Ihnen galt keineswegs nur der vielbeschworene Dank des Vaterlandes. Vielmehr richtete sich die Aufmerksamkeit der Herrschenden angesichts anschwellender Proteste und Streiks der Zivilgesellschaft spätestens seit 1917 zunehmend auf vermeintlich „subversive Elemente“ unter den Kriegsbeschädigten. Während die Gefallenen schwiegen, schien sich unter den Überlebenden eine bedrohliche politische Energie zu entwickeln. Und solche Sorgen waren durchaus berechtigt, denn Amputation, Blind- oder Taubheit behinderten keineswegs die Agitationsfähigkeit der Kriegsbeschädigten. Hinzu kam, dass die überwiegende Zahl der Kriegsbeschädigten im Zivilleben Arbeiter gewesen waren. Sie kannten den Gewerkschaftskampf für ihre Interessen und gegen ihre Arbeitgeber. Sie hatten für den Staat nicht nur Kriegsdienst geleistet, sondern ihm mit ihren beschädigten Körpern auch physische Opfer gebracht. Ihre wirtschaftliche Not, ihre körperliche Beschädigung, seelische Traumatisierung und der Vertrauensverlust in einen Staat, der seinen Versorgungspflichten nicht in dem zu erwartenden Maße nachkommen konnte, bildeten in der Republik von Weimar ein explosives Gemisch, das bald zu Recht auch als ernstzunehmende Gefahr gedeutet wurde.
Ein Beitrag von Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart in Momente 3|2018.