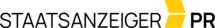Das Geld der kleinen Leute
Verlorene Pfennige unter Kirchenbänken verraten einiges über den Geldgebrauch im Spätmittelalter
Wenn wir beim Bäcker mit großen Scheinen zahlen, die Hotelrechnung dagegen in kleiner Münze begleichen, dann verärgern wir die Empfänger des Geldes. Barzahlungen sollen heutzutage in angemessener Form erfolgen. In der Tat ist niemand verpflichtet, mehr als fünfzig Münzen der Euro-Währung auf einmal anzunehmen (Verordnung Nr. 974/98 über die Einführung des Euro, Art. 11).
Die Annehmlichkeit, je nach Höhe des Betrages auf passendes Bargeld zurückgreifen zu können, verdanken wir dem späteren Mittelalter. In den wirtschaftlich hoch entwickelten Kommunen
Oberitaliens verwendete man schon im späten 12. Jahrhundert sowohl leichte Pfennige für alltägliche Einkäufe als auch schwerere Silbermünzen („grossi“) für größere Zahlungen. Nach der Mitte des 13. Jahrhunderts kamen Goldmünzen für die Bedürfnisse des Groß- und Fernhandels hinzu. Die Gliederung des Geldumlaufs in genau diese drei Wertebenen bestand bis weit in die Neuzeit.
In Südwestdeutschland setzte sich dieses System ab etwa 1300 durch. Bis dahin waren silberne Pfennige die einzige Münzsorte gewesen; doch seither liefen die Pfennige nur mehr als Kleingeld neben den Groschen und Schillingen aus schwerem Silber sowie den Gulden und Dukaten aus Gold um.
Über die höheren Wertebenen wissen wir heute weitaus besser Bescheid als über das Kleingeld. Denn in den großen Münzsammlungen, wie zum Beispiel in den Münzkabinetten der Landesmuseen in Karlsruhe und Stuttgart, schenkte man den schönen und wertvollen Münzen lange Zeit mehr Aufmerksamkeit als dem unscheinbaren Kleingeld. Auch spektakuläre Schatzfunde mit großen, wertbeständigen Münzen stießen eher auf wissenschaftliches Interesse als einfache Pfennigfunde.
Diese Geringschätzung des Kleingeldes ist jedoch sachlich nicht gerechtfertigt: Wer den Pfennig nicht ehrt, verschenkt Einsichten in die Sozialgeschichte. Denn im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit kam schätzungsweise ein Drittel der Menschen mit Gold- und großen Silbermünzen kaum oder gar nicht in Berührung, sondern tätigte alle Geldgeschäfte mit Kleingeld.
Einblicke in dieses Geld der kleinen Leute vermitteln uns zum Beispiel die archäologischen Ausgrabungen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg und hier ganz besonders die Ausgrabungen in Kirchen. Denn die Kirche ist ein Ort, an dem immer schon mit Kleingeld umgegangen wurde. Sowohl in evangelischen als auch in katholischen Orten erwartete man vom Kirchgänger beim Sonntagsgottesdienst Regelmäßig ein finanzielles Opfer. Üblicherweise wurde es in kleiner Münze entrichtet. Und immer wieder fielen dabei Geldstücke zu Boden und verschwanden in einem Spalt zwischen den hölzernen Kirchenbänken. Dort blieben sie versteckt, bis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei vielen Kirchenrenovierungen in Baden-Württemberg auch in die alten Fußböden eingegriffen wurde. Sooft die Archäologen die Baumaßnahmen begleiteten und den Aushub siebten, kam das „für immer“ verlorene Kleingeld wieder ans Tageslicht. Heute ist es eine beachtliche Quelle für den Münzumlauf der Vergangenheit auf der unteren Wertebene.
Ein schönes Beispiel hierfür sind die 338 Münzen, die in der Konstanzer Stadtpfarrkirche St. Stephan zutage kamen, als in den Jahren 1982/83 und 1988/89 eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Mehr als die Hälfte davon wurde im 14. und 15. Jahrhundert geprägt; diese Münzen bilden eine willkommene Stichprobe aus dem Kleingeldumlauf des Spätmittelalters. Demnach war im 14. Jahrhundert der Heller die gebräuchlichste Kleinmünze in Konstanz wie im gesamten Südwesten.
Der Heller war der kleine und leichte Pfennig der königlichen Münzstätte in Schwäbisch Hall, von der er seinen Namen hat. Er wog etwa 0,6 Gramm und bestand nur zu einem Drittel aus Silber. Auf der einen Seite zeigte er eine Hand und auf der anderen Seite ein charakteristisches Kreuz mit gegabelten Enden. Die Gründe für diese Motivwahl sind nicht bekannt. Das Kreuz wird als Marktkreuz gedeutet. Die Hand mag für den Handschuh Friedrichs I. Barbarossa stehen, den er nach Schwäbisch Hall sandte, um damit sein Einverständnis zur Einrichtung von Markt und Münze zu bezeugen – oder aber als Hand Gottes. Der Heller kam dem Bedürfnis nach einer massenhaft verfügbaren Münze für kleine Einkäufe entgegen. Deshalb nahmen im 14. Jahrhundert weitere Münzstätten die Prägung von Hellern nach Schwäbisch Haller Vorbild auf. Weil sie gelegentlich am Münzsilber sparten, provozierten sie Unklarheiten über den Wert ihrer Münzen.
Seit dem späten 14. Jahrhundert versuchten die südwestdeutschen Münzherrschaften, den Geldumlauf in Schwaben zu vereinheitlichen und zumindest für die unteren Wertstufen eine dauerhafte, überschaubare Ordnung einzurichten. Die Stadt Konstanz vertrat in dieser Frage die Münzherrschaften am Bodensee und verständigte sich 1404 mit der Stadt Ulm und dem Grafen von Württemberg auf eine gemeinsame Prägung von Hellern, Pfennigen und Schillingen für weite Teile Schwabens. In der Folgezeit waren einige Nachbesserungen notwendig: 1417 wurde Zürich einbezogen; 1423 schlossen die schwäbischen Münzherrschaften in Riedlingen einen umfassenden Münzbund, der Stuttgart, Konstanz und Ulm als Bundesmünzstätten vorsah.
Die Fundmünzen aus der Stephanskirche belegen den Erfolg der damals vereinbarten Maßnahmen, insofern Heller und Pfennige, die nach diesen Verträgen geprägt wurden, besonders zahlreich vertreten sind. Trotzdem kam keine vollständige Einheitlichkeit des Kleingeldumlaufs zustande, weil weiterhin kleine Münzen aus den Nachbarländern einströmten, insbesondere aus eidgenössischen Münzstätten. Kleinmünzen von weiter her, etwa aus Italien, bildeten die Ausnahme. Der Kleingeldumlauf war regional begrenzt.
Der Befund aus der Stephanskirche zeigt uns, dass Pfennige die typischen Opfermünzen des 15. Jahrhunderts waren. Wie es scheint, kam ihnen diese Funktion nicht nur beim sonntäglichen Kirchgang zu: Als 1415 der Kardinal Landulf von Bari in Konstanz starb und in der Dominikanerkirche aufgebahrt wurde, stellte man zu seinen Füßen ein Becken mit Pfennigen auf, aus dem sich die ärmeren Besucher der Totenfeier bedienen durften, um ein angemessenes Opfer leisten zu können. Auch andere regelmäßige Abgaben wie beispielsweise die Mitgliederbeiträge der Zünfte und Bruderschaften wurden in Pfennigen bezahlt.
Kurzum, der handliche Pfennig war vielseitig einsetzbar. Doch was war er wert? Was opferte jemand, der einen Pfennig gab? Darüber informieren uns zeitgenössische Angaben über Preise und Löhne, die für das 15. Jahrhundert erstmals in befriedigender Dichte vorliegen. Der Konstanzer Chronist Ulrich Richental verzeichnete ausführlich die Preise für Grundnahrungsmittel, Viehfutter, Brennholz und Übernachtungsgelegenheiten, die in Konstanz zur Zeit des Konzils (1414 – 1418) bezahlt werden mussten. Demnach konnte man für einen Pfennig ein gutes Weißbrot erwerben, zwei Eier, eine halbe Amsel, ein halbes Pfund Schweinefleisch oder eine halbe Maß „guten Knechtwein“. Weit kam man also nicht damit. Dennoch darf man den Wert des Pfennigs nicht unterschätzen, wie ein Blick auf die Löhne für unqualifizierte Arbeit beweist: Eine Frau, die eine Bürde Stroh aus dem etwa 6 Kilometer entfernten Wollmatingen nach Konstanz trug, erhielt dafür 6 Pfennig; Hilfsdienste beim Befestigungsbau wurden mit 18 Pfennig am Tag vergütet.
Bei der Verarbeitung all dieser Informationen wirken verschiedene historische Disziplinen zusammen: Archäologen untersuchen den Befund im Boden und stellen die Fundmünzen als Sachquellen bereit. Numismatiker bestimmen die Münzen und ordnen sie in ihren geldgeschichtlichen Kontext ein. Wirtschaftsund Sozialhistoriker bereiten die flankierenden Schriftquellen auf und werten sie aus. Wenn die Zusammenführung der Ergebnisse gelingt, lässt sich ein Stück spätmittelalterlicher Alltagserfahrung umreißen.
Ein Beitrag von Harald Derschka in Momente 4|2013.
Dr. Harald Derschka ist Privatdozent für mittelalterliche Geschichte an der Universität Konstanz, mit Schwerpunkten in der Ideengeschichte, der Geldgeschichte sowie der Rechts- und Landesgeschichte.