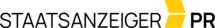Mit 26 Dienstjahren hält der Jurist Willi Geiger den Rekord für die längste Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichts. Als er am 19. Januar 1994 stirbt, erscheinen wohlwollende Nachrufe über den Richter, der bis zu seinem Ausscheiden als heimlicher Vorsitzender des Zweiten Senats oder einfach als „der starke Mann aus Karlsruhe“ gilt.
Willi Geiger wird am 22. Mai 1909 in Neustadt an der Weinstraße geboren – hinein in ein katholisch-konservatives Milieu. Als Sohn eines Bezirksschulrates steht er wie dieser der bayerischen Volkspartei und der „Bayernwacht“ nahe, die in der Weimarer Republik als Schutzorganisation der BVP dient. Später ist Geiger im „Stahlhelm“ aktiv, mit dessen Selbstgleichschaltung wird er Mitglied der SA und 1939 sogar SA-Rottenführer.
Noch während der Republik besteht Geiger die erste juristische Staatsprüfung mit „gut“, vier Jahre später das zweite Staatsexamen mit „lobenswert“. Geiger ist talentiert, fleißig, und: anpassungsfähig. Am 1. Juli 1936 wird er in den richterlichen Probedienst übernommen – schon 1938 wird er Landgerichtsrat, kurz darauf Hilfsrichter am Oberlandesgericht in Bamberg. Dort hält er Vorträge für den „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund“, NSDAP-Mitglied ist er schon seit 1937. Im Herbst 1939 wird Geiger zur Staatsanwaltschaft Bamberg abgeordnet und fungiert als Dezernent für Sondergerichtssachen, ab 1941 als Staatsanwalt.
In dieser Position erwirkt Willi Geiger bis 1943 mindestens fünf Todesurteile. Eines gegen einen 18-Jährigen wegen sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen, die etwas jünger als dieser. Für Geiger eine „volksfremde Person“, die „ausgemerzt“ werden müsse und deren Hinrichtung er besucht. Ein anderes Todesurteil trifft einen polnischen Zwangsarbeiter, der sich mit dem Taschenmesser verteidigt, als er von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen wird.
1941 promoviert Geiger über die „Rechtsstellung des Schriftleiters nach dem Gesetz vom 4. Oktober 1933“. Das Gesetz beseitige, laut Geiger, „mit einem Schlag den übermächtigen, volksschädigenden und kulturverletzenden Einfluß der jüdischen Rasse auf dem Gebiet der Presse“. Entscheidend für die Ausübung des Schriftleiter-Amtes seien die „erforderlichen persönlichen Eigenschaften“ des Journalisten – „Nicht-Arier“ zu sein ist ein Ausschlusskriterium. Dadurch, so Geiger, sei es gelungen, den deutschen Journalismus von unerwünschten „Elementen“ zu säubern und „der marxistischen Presse“ den Garaus zu machen.
Nach dem Sieg der Alliierten über Nazideutschland übersteht Geiger die Entnazifizierung als „Entlasteter“ und schreibt am Grundgesetz des neuen deutschen Staates mit. Sein rasanter Aufstieg der 30er-Jahre wiederholt sich. Als sogenannter „neutraler“ Richter wird er 1950 an den Bundesgerichtshof berufen. Ein Jahr später wird er gleichzeitig Richter am Bundesverfassungsgericht – zehn Jahre lang in Doppelfunktion.
In Geigers Amtszeit als Verfassungsrichter fallen wegweisende Entscheidungen. Er prägt die Urteile zur Wiederbewaffnung und zum Grundlagenvertrag maßgeblich mit. 1975 bereitet Geiger das Verfassungsgerichtsurteil zu den antilinken Berufsverboten vor. Fortan können Bewerber vom Staatsdienst ausgeschlossen werden, wenn sie in einer „verfassungsfeindlichen“ Organisation Mitglied sind oder Kontakt zu einer solchen haben. In der Urteilsbegründung heißt es, dass sich Beamte zur freiheitlich- demokratischen Grundordnung bekennen müssen. Für Willi Geiger ist erneut die Persönlichkeit des Bewerbers entscheidend, die er an äußeren Kriterien festmacht.
Ein Beitrag von Moritz Binkele in Momente 4|2017.