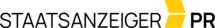„Mit der Digitalisierung eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten“

Stuttgart/Müllheim. Auch die Museen müssen sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. Der Museumsverband Baden-Württemberg greift das Thema für seine Tagung im März auf. Unter dem Motto „Digitales Sammlungsmanagement“ sollen Chancen und Risiken erörtert werden. Tilmann von Stockhausen, Leitender Direktor der städtischen Museen Freiburg und im Vorstand des Verbands, ist mit dabei.
Staatsanzeiger: Der Museumsverband thematisiert in seiner Tagung im März „Digitales Sammlungsmanagement“. Was muss man sich darunter vorstellen?
Tilmann von Stockhausen: In der Grundform ist das etwas, was wir seit Jahren machen: Das Inventarisieren unserer Objekt- und Datenbestände mithilfe eines Computerprogramms. Aber die Digitalisierung geht viel weiter und spielt in der Vermittlung eine zunehmende Rolle. Es geht darum, die Objekte, die das Museum vor Ort zeigt, online zu präsentieren und zu erläutern, beziehungsweise die Bestände eines Hauses, die digitalisiert sind, in einer größeren Plattform dann auch online verfügbar zu machen. Außerdem führt die Digitalisierung zu einer Vernetzung aller Arbeitsprozesse in den jeweiligen Einrichtungen. Für Museen bedeutet dies, dass die Inventarisierungssoftware zukünftig die Basis für alle Arbeitsprozesse sein kann und auch sein wird.
Ist das digitale Sammlungsmanagement für Museen zwingend notwendig?
Ich glaube, dass ein digitales Sammlungsmanagement zwingend notwendig wird und dass wir uns auf keinen Fall dieser Entwicklung verschließen dürfen. Einzelne Museen haben den Schritt ja bereits vollzogen. Allerdings sind viele, vor allem kleinere Museen nicht so professionell oder personell so gut aufgestellt, um diesen Schritt allein zu bewältigen. Schon bei einem mittleren Haus wie beispielsweise bei dem von mir geleiteten Augustinermuseum gibt es Debatten, wie wir diese Aufgabe bewältigen können. Auch wir haben nicht die personellen Ressourcen und müssen abwägen, wie wir unsere Mittel umschichten können und welche Priorisierung wir vornehmen. Für kleinere Häuser ist das noch schwieriger. Hier ist die Politik noch mehr gefordert.
Aber Digitalisierung wird doch im Land, auch was den Kulturbereich betrifft, derzeit groß geschrieben. Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hat gerade ein Coaching-Programm für Museen unter dem Titel „Museen 2.0“ gestartet, das sich mit den digitalen Herausforderungen beschäftigt...
Wir nehmen sogar an diesem Programm teil. Ich bin sehr gespannt, und freue mich, dass es diese Initiative gibt. Aber es ist sehr wichtig, dass man nicht in puren Aktionismus verfällt und nur punktuell fördert. Wir brauchen Förderung in der Breite, damit alle Häuser in der Lage sind, diese technische Herausforderung zu bewältigen. Das Ganze macht nur Sinn, wenn Datenbestände verknüpft werden. In Deutschland haben wir das Problem, dass durch die föderale Struktur und die Vielfalt der Museumslandschaft mit unterschiedlichsten Trägerschaften diese Vernetzung nicht ganz einfach ist. Es gibt zwar bereits Einrichtungen wie etwa die Deutsche Digitale Bibliothek, die Datenbestände aus allen Teilen Deutschlands zusammenführt, aber in Frankreich, den Niederlanden und in Großbritannien ist man da schon viel weiter.
Alle Bestände zu digitalisieren ist indes eine Mammutaufgabe. Gerade hat das Badisches Landesmuseum verkündet, seinen kompletten Bestand bis 2018 digitalisieren zu wollen. Ist das überhaupt machbar?
Natürlich ist das eine Mammutaufgabe. Was aber eigentlich die wichtigere Frage ist und was intern derzeit auch diskutiert wird ist wie, das heißt in welcher Tiefe beziehungsweise Ausführlichkeit man die Digitalisate ins Netz stellt. Hier muss man allgemeingültige Standards festlegen. Auch wir an unserem Haus diskutieren darüber, ob wir lieber einen kleinen Bestand als Highlight-Katalog ins Netz stellen, mit professionellen Fotografien oder sogar 3D-Ausmessungen und mit detaillierten Beschreibungen. Oder ob wir uns eher mit einem breiten Angebot präsentieren und den Bestand mit Basisinformationen öffentlich machen, die der Wissenschaft einen Überblick über unsere Bestände bieten. Das sind zwei Wege, die man gehen kann. Vielleicht muss man auch beide Wege parallel beschreiten, hier bedarf es aber landesweiter oder auch bundesweiter Empfehlungen.
In Frankreich und Großbritannien sind nationale Standards definiert worden. Wegen der Kulturhoheit der Länder müssen diese auch in Deutschland federführend tätig werden. In Baden-Württemberg gibt es dazu positive Ansätze. Auch in der Vergangenheit wurde schon einiges gemacht, etwa indem man das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) in Konstanz förderte, das ja eine Landeseinrichtung ist und auch die Inventarisierung an den Landesmuseen betreut, auch das Augustinermuseum in Freiburg hat einen Vertrag mit dem BSZ. Man darf bestehende und funktionierende Strukturen nicht eintrocknen lassen, sondern muss diese weiter fördern und entwickeln.
Wie weit sind die Städtischen Museen Freiburg mit der Digitalisierung?
Im Vergleich zu vielen anderen Häusern sind wir sehr weit was die klassische Inventarisierung mithilfe von Computerprogrammen angeht. Unser Datenbestand, etwa vom Augustinermuseum, ist mit über 90 Prozent erfasst. Nun müssen wir aber daran arbeiten, die Bilddaten und Datensätze so aufzubereiten, dass wir sie online stellen können. Für uns stellt sich derzeit die Frage, ob wir jeden Datensatz noch einmal neu betrachten und ihn redaktionell aufbereiten oder ob wir einfach alles online stellen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen.
Erfordern diese neuen Aufgaben auch neue Stellen und Berufsbilder?
Wir hatten stets eine Stelle nur für Dokumentation und Inventarisierung. Diese wurde gerade neu besetzt. Sie ist etwas verändert worden, ein Schwerpunkt der Arbeit ist in Zukunft die Onlinestellung der Kataloge, also der Schritt in die Öffentlichkeit. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Die Menschen sollen an unseren Sammlungsbeständen partizipieren, dieses ist eine Aufgabe demokatrischer Instititutionen. Mit der Digitalisierung eröffnen sich dahingehend ganz neue Möglichkeiten. Wir könnten uns beispielsweise überlegen, wenn alle Objekte des Augustinermuseums online gestellt sind, auch Mechanismen zu adaptieren, die im Netz längst gang und gebe sind. Wir könnten Likes und Kommentarfunktionen einführen und die Online-Community könnte mitforschen. Wir könnten beispielsweise unseren kleinen „Amor mit brennendem Pfeil“ von Hans Baldung Grien twittern lassen...
Seitens der Museen gibt es aber auch Ängste, etwa im Netz die Kontrolle über die eigene Inhalte zu verlieren oder sich gar überflüssig zu machen. Teilen Sie diese?
Es gibt viele Ängste, beispielsweise dass bei den Objekten, die man wissenschaftlich betreut und bearbeitet, dann andere mitmischen und –reden wollen. Ich denke aber, das ist unbegründet, die Fachkompetenz der Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja unbestritten. Man kann nicht immer Kataloge machen, aber man kann seine Objekte ins Netz stellen und so mit der Öffentlichkeit kommunizieren, mit der Forschung weltweit in Verbindung treten und für das Haus werben. Ich persönlich sehe mehr Chancen als Risiken. Natürlich gibt es Risiken, etwa was die Frage der Bildrechte betrifft. Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Das Rijksmuseum in Amsterdam und das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg beispielsweise stellen ihre Bilddaten in hoher Auflösbarkeit der Öffentlichkeit ohne Gebühren zur Verfügung.
Der User als Kurator?
Ja, das ist möglich. Man könnte aber auch an Ausstellungen, die im Museum gemacht werden partizipieren. Man könnte die Öffentlichkeit beteiligen, indem man aus einem größeren Bestand, der für eine Schau in Frage kommt, auswählen lässt. Der Wermutstropfen ist, dass für diesen Beteiligungsprozess sehr viel Arbeit und technisches Wissen Voraussetzung ist. Daher muss die öffentliche Hand eine Beratungs- und Unterstützungsinstanz einrichten, die auch dafür sorgt, dass es keinen Datensalat gibt. Das Bibliotheksservice-Zentrum in Konstanz ist ein guter Ansatz. Aber dieser müsste wesentlich ausgebaut werden und sich gegenüber allen kleineren, auch ehrenamtlich geführten Häusern öffnen. Digitalisierung braucht Kontinuität, die entsprechenden Förderinstrumente und professionelle Beratung für alle Museen.
Kontakt
 Ihre Ansprechpartnerin in der Redaktion
Ihre Ansprechpartnerin in der RedaktionPraktikums-Tagebuch
Studierende der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Ludwigsburg berichten über ihr Praktikum im Rahmen des Praxisjahrs im Vertiefungsschwerpunkt Kommunalpolitik/ Führung im öffentlichen Sektor beim Staatsanzeiger.
Der Kommunal-Newsletter

Wissenswertes zu kommunalpolitischen Themen für Sie als Gemeinderat/Gemeinderätin mit einem wöchentlichen Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Sie jetzt den
Kommunal-Newsletter.