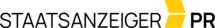„Die Kommune hat eine Doppelrolle in der Entwicklung von Prävention“

Stuttgart/Berlin. Rolf Rosenbrock, seit 2012 Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Berlin, betreibt seit rund vier Jahrzehnten Gesundheitsforschung. Er befürwortet eine Gesundheitsförderung und Prävention, die bei den Lebenswelten – Settings – ansetzt. Was in diesem Punkt Kommunen von Betrieben lernen können, welche Rolle Vereinen und Musikschulen zukommt und wo das größte Problem bei lebensweltlichen Interventionen liegt, erörtert er im Gespräch mit Christoph Müller.
Seit den 1970er-Jahren bereits beschäftigen Sie sich mit dem Thema Prävention. Welche Fortschritte hat es auf diesem Gebiet gegeben?
Vor 40 Jahren stand immer der Ansatz im Vordergrund, die Menschen mehr zu informieren über Gesundheitsrisiken und darauf zu hoffen, dass sich dadurch ihre Einstellung und dann ihr Verhalten verändert. Mittlerweile ist klar geworden, dass es nicht nur darum geht, sich auf die Gesundheitsbelastungen zu konzentrieren. Sondern mindestens im gleichen Umfang auch auf die Entwicklung von Gesundheitsressourcen. Das bedeutet und erfordert, vor allem Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsgefühl und soziale Vernetzung in den Blick zu nehmen. Zum anderen ist klar geworden, dass Gesundheitskompetenz im weiteren Sinn eigentlich im täglichen Leben erlernt werden kann - und nur so erlernt werden kann. Und dass gute Prävention immer im Wechselspiel zwischen Verhältnisänderung einerseits und Verhaltensänderung andererseits stattfindet.
Stichwort Verhältnisänderung. Da spielt die Lebenswelt eine wesentliche Rolle, der Setting-Ansatz, auf den Sie großen Wert legen. Wie würden Sie diesen kurz definieren?
Ein Setting ist jeder soziale Zusammenhang, der den Teilnehmern bewusst ist, der ihnen wichtig und der einigermaßen verbindlich ist und von dem wichtige Impulse in Hinblick auf Gesundheit, seien es positive oder negative, ausgehen. Das kann nun eine feste Organisation sein wie eine Kita, eine Schule, ein Betrieb, oder ein räumlicher Zusammenhang, etwa ein sozialer Brennpunkt, ein Stadtteil. Es kommt immer darauf an, die in dieser Lebenswelt vorhandenen Akteure, also die Nutzer, die Betreiber, die sonstigen Interessenten zusammenzubringen und einen Prozess zu initiieren, in dem sich die Beteiligten darüber klar werden, in welche Richtung sich das Setting entwickeln soll. Im Grunde genommen ist ein Setting-Prozess eine partizipative Organisationsentwicklung. Das setzt voraus, dass er von vornherein partizipativ stattfindet und Nutzern der Settings tatsächlich die Möglichkeit gegeben wird, ihr Setting besser nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Viele Settings stehen in Zusammenhang mit Kommunen oder die Kommunen sind für diese Settings zuständig - Schulen beispielsweise. Inwiefern haben die Kommunen mittlerweile erkannt, dass sie Verantwortung für Gesundheitsförderung und Prävention ihrer Bewohner haben? Eine Grunderkenntnis über die Notwendigkeit, etwas zu tun, ist weit verbreitet. Schwieriger ist es mit der Kenntnis der Möglichkeiten, etwas zu bewirken. Und ob eine Kommune handelt, hängt davon ab, ob sie den Grund für das Handeln erkennt, ob sie Motivation und Fertigkeiten besitzt, das zu tun – und vor allem, ob sie die Ressourcen dafür hat. Da sind sich die Kommunen ihrer großen Rolle noch nicht durchweg bewusst. Wir haben bisher die besten Erfahrungen mit Setting-Ansätzen in der betrieblichen Gesundheitsförderung gemacht.
Gibt es solche Vorbilder und Musterprojekte bisher etwa bloß in Betrieben?
Nein. Gottseidank sind wir schon ein bisschen weiter. Die Kommune hat gewissermaßen eine Doppelrolle in der Entwicklung von Prävention. Zum einen befinden sich wichtige Settings in der Verantwortung der Kommunalverwaltung – zum Beispiel Kitas, Schulen, manchmal auch Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen – und können also direkt motiviert und einbezogen werden.
Zum anderen hat die Kommune gerade für wichtige Zielgruppen wie Kinder zusätzlich die Funktion, übergreifend Settings koordinieren zu können und zivilgesellschaftliche und Akteure der Krankenversorgung einzubeziehen. Für diesen ungleich komplexeren Interventionstyp gibt es schon gute und prämierte Beispiele. So etwa die Präventionskette für Neugeborene und Kleinkinder in Dormagen. Dort wird jede Schwangere besucht – tatsächlich jede, ohne soziale Diskriminierung. So ist dafür gesorgt, dass Schwangere und junge Mütter, je nach Bedarf, durch Familienhebammen, Frühförderung, frühe Hilfen und Elterngruppen, bis hin zu gesundheitsförderlichen Kindertagesstätten und Schulen, quasi lückenlos begleitet werden. Wir machen dergleichen auch hier in Berlin mit einigen Bezirksämtern. Was in Baden-Württemberg in diesem Bereich passiert, weiß ich schlicht nicht.
Inwiefern können Vereine eine wichtige Rolle spielen? In Baden-Württemberg sind diese traditionell stark.
In jedem guten Sportverein wird Gesundheitsförderung betrieben. Das Problem der Vereine im Hinblick auf Gesundheitsförderung ist oft, dass die, die den größten objektiven Bedarf haben, dort nicht hinfinden. Die Zusammenarbeit mit der Jugend- und Sozialverwaltung und natürlich den Schulen kann helfen, den Zugang zu Sportvereinen zu verbessern und die Mitgliedschaft zu unterstützen. Das gleiche gilt für Musikschulen. Da wird schon durch das gemeinsame Musizieren Gesundheitsförderung betrieben. An solche Aktivitäten muss angeknüpft werden, um die Motivation, die Kinder und Jugendlichen dort erfahren, auch in anderen Lebensbereichen wirksam werden zu lassen.
Ist vorrangig Geld erforderlich oder ist anderes wichtiger für das Gelingen?
Das Geld ist schon auch wichtig. Die Kommunen in Deutschland sind mittlerweile mit insgesamt circa 130 Milliarden Euro verschuldet. Über ein Drittel davon sind Kassenkredite. Das bedeutet, dass die Kommunen dann praktisch kaum noch Ressourcen haben, in freiwillige Aufgaben zu investieren, wie etwa Sport und Kultur. Und gerade diese sind natürlich für die Gesundheitsförderung enorm wichtig.
Aber es hängt nicht nur am Geld, zumal solche Gesundheitsprojekte nicht teuer sind. Es gibt aber auch Engpässe schon in den Ämtern, die einbezogen werden müssen, oder in den Fachdiensten, die oft erst einmal motiviert und befähigt werden müssen, wirklich offen Kooperation nicht nur innerhalb der Verwaltung zu praktizieren, sondern sich eben auch zivilgesellschaftlichen Akteuren, Bürgerinitiativen, Vereinen gegenüber zu öffnen und auf gleicher Augenhöhe mit ihnen zu kooperieren. Ein solches koordiniertes Handeln entsteht nicht von selbst. Da braucht man Geduld, zum Teil auch professionelle Begleitung. Das ist nichts, was vom Himmel fällt.
Sie haben die prekäre finanzielle Lage der Kommunen angesprochen. Wie kann man diese trotzdem dazu bewegen, mehr in diesem Bereich zu tun?
Es nutzt nichts, darum herumzureden. Wo kein Geld ist, kann nicht viel passieren. Geschickte Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister finden immer noch irgendwo Geld oder beteiligen sich an Bundes- oder EU-Programmen.
Oft wird allerdings auch quasi Etikettenschwindel betrieben. Dann wird verkündet, man betreibe Gesundheitsförderung. Aber wenn man hinschaut, geht es doch wieder nur um Ermahnungen, Flugblätter und gute Worte. Das ist dem Thema sehr abträglich. Ebenso wie die zu kurzfristige Förderung der meisten Projekte. So etwas kann gar nicht dazu führen, dass wirklich nachhaltige Wirkungen erzielt und dann auch nachgewiesen werden können. Deshalb ist neben guten Ideen, einer motivierten Koalition von Akteuren und einer soliden partizipativen Projektorganisation eine stabile, langfristige Finanzierung unerlässlich. Sehr viel kann über Abgucken und Lernen gelöst werden, dass man sich also damit vertraut macht: Wie haben andere Kommunen die hemmenden Bedingungen einer solchen Projektentwicklung überwunden? Wer muss einbezogen werden? Was muss man tun, um in großen Städten zum Beispiel Migrantenselbstorganisationen, Arbeitsloseninitiativen oder auch die Jobcenter und Arbeitsagenturen einzubeziehen? Denn die kommunal begründeten Setting-Projekte haben eigentlich immer primär die Aufgabe, einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit zu leisten, und das heißt, sich vorwiegend an sozial Benachteiligte zu richten.
Um gerade Kindern aus sozial benachteiligten Familien bessere Gesundheitschancen zu eröffnen, was muss da getan werden?
Kinder und Jugendliche sind die Gruppen, für die sich am leichtesten Öffentlichkeit mobilisieren lässt. Weil das jeder sofort einsieht. Aber wir haben auch viele andere Problem-Gruppen, vor allem in größeren Kommunen. Wir haben Langzeitarbeitslose, die - wenn man sich nicht um sie kümmert - in die Apathie abrutschen und dann als Dauer-Hartz IV-er diskriminiert werden, was die Lage nur noch schlimmer macht. Wir haben aber auch viele arme, alte, multimorbide Menschen, deren Hauptproblem das Abrutschen in die Vereinsamung ist. Wir haben aber natürlich auch überforderte Eltern. Alleinerziehende mit mehreren Kindern sind eine ganz problembeladene Gruppe. Kinder sind die Gruppe, für die schon am meisten überlegt und zum Teil schon getan wird. Aber hinter den Kindern warten eine ganze Reihe weiterer, die ebenfalls Zuwendung benötigen und verdienen.
Sie bezeichnen Lebensweltliche Interventionen selbst als komplex und störanfällig. Was ist das größte Problem?
Ist ein Projekt erst einmal zustande gekommen, ist die häufigste Störung das Ende der Finanzierung. Komplexität bedeutet, dass immer mehrere Akteure, also Ämter, Vereine, Teile des Krankenversorgungssystems, die jeweils nach ihrer eigenen Logik funktionieren, vertrauensvoll und routiniert miteinander kooperieren müssen. Das hängt oft an einzelnen Personen. Da muss man viel investieren, um die Voraussetzungen für Kooperationsfähigkeit zu schaffen. Da braucht es oft professionelle Begleitung und in den Ämtern oder Fachdiensten interne Prozesse, um diesen die Einsicht zu vermitteln, dass sie in der Kooperation mit anderen Akteuren nicht davon ausgehen können, dass diese ebenso ticken wie sie selber. Im Ergebnis sollen alle Beteiligten lernen, die Lebenslage und die Gesundheitsprobleme der Zielgruppe zunächst einmal durch deren Brille zu sehen und daraus abzuleiten, was sie jeweils in Kooperation mit den anderen Akteuren tun können und sollen.
Welche Bedeutung haben Initiativen wie das Netzwerk Gesunde Städte?
Das Netzwerk Gesunde Städte hat seit den 1980er-Jahren sicherlich wichtige Impulse gesetzt, um die Notwendigkeit kommunaler Prävention in den Köpfen zu verankern. Und es hat den richtigen Grundgedanken verbreitet, dass kommunale Präventionsstrategien immer auch die Unterstützung der Spitze brauchen – der Verwaltungsspitze oder der gewählten Spitze, möglichst beider. Das Gesunde-Städte-Netzwerk stößt auch nach wie vor viele sinnvolle Projekte und Kampagnen auf kommunaler Ebene an.
Zu nennen ist auch der Kooperationsverbund ‚Gesundheitliche Chancengleichheit‘, einem Zusammenschluss von mehr als 50 gewichtigen Organisationen, darunter auch den kommunalen Spitzenverbänden. In diesem, im Jahre 2003 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gegründeten Netzwerk liegt der Schwerpunkt seit einigen Jahren ebenfalls auf der Förderung der Prävention und Gesundheitsförderung in den Kommunen.
Kontakt
 Ihre Ansprechpartnerin in der Redaktion
Ihre Ansprechpartnerin in der RedaktionPraktikums-Tagebuch
Studierende der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Ludwigsburg berichten über ihr Praktikum im Rahmen des Praxisjahrs im Vertiefungsschwerpunkt Kommunalpolitik/ Führung im öffentlichen Sektor beim Staatsanzeiger.
Der Kommunal-Newsletter

Wissenswertes zu kommunalpolitischen Themen für Sie als Gemeinderat/Gemeinderätin mit einem wöchentlichen Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Sie jetzt den
Kommunal-Newsletter.