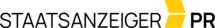Bürgermeisterinnen verzweifelt gesucht

Ludwigsburg/Kehl. 1973 wurden die beiden Verwaltungshochschulen gegründet. 40 Jahre später ziehen ihre Rektoren, Claudia Stöckle aus Ludwigsburg und Paul Witt aus Kehl, eine positive Bilanz. Sie sehen aber auch Probleme, etwa beim Frauenanteil und der Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master.
Frau Stöckle, Ihre Hochschule ist außerhalb eines Fachpublikums nicht allzu vielen Menschen bekannt. Blicken Sie manchmal neidisch auf Ihre Kollegen an den Universitäten, die eher im Rampenlicht stehen als Sie?
Claudia Stöckle: Überhaupt nicht, weil wir bei diesem Fachpublikum, bei dem wir bekannt sind, eine enorme Unterstützung erfahren. Ich vergleiche uns manchmal mit Soldaten – die haben auch so einen Korpsgeist wie unsere Studierenden. Unsere Absolventen halten die Treue zu ihrer Hochschule, auch wenn sie längst im Beruf stehen. Sie unterstützen uns im Rahmen der Ausbildung, indem sie die Betreuung in den Praxisphasen übernehmen.
Herr Witt, man kann Verwaltungswissenschaften auch an der Uni studieren. Warum würden Sie einem Abiturienten raten, an eine Verwaltungshochschule zu gehen?
Paul Witt: Für uns sprechen die Breite und der Praxisbezug der Ausbildung – schließlich bilden wir für allen Ebenen und Bereiche des gehobenen Diensts aus. Und der Umstand, dass unsere Studierenden nach ihrem Abschluss so gut wie sicher eine Stelle in der öffentlichen Verwaltung finden.
Gibt es auch Schulabgänger, denen Sie davon abraten würden?
Witt: Die gibt es durchaus auch. Wer stärker wissenschaftlich arbeiten will, ist möglicherweise an einer Uni wie in Konstanz besser aufgehoben. Andererseits gibt es nicht wenige Studienabbrecher, beispielsweise ehemalige Jura-Studenten, die bei uns landen, weil sie sagen: Hier sind die Gruppen kleiner, hier ist die Betreuung intensiver, wir kommen an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften besser zurecht.
Ihre Studenten erhalten ein ordentliches Ausbildungsgehalt. Ist das gerechtfertigt?
Stöckle: Die Situation ist etwa dieselbe wie an der Dualen Hochschule. Auch dort bekommen die Studenten in etwa 1000 Euro im Monat. Das halte ich für gerechtfertigt. Es sind schließlich Beamtinnen und Beamte und keine externen Studierenden. Und als Beamtin oder Beamter habe ich auch Pflichten, zum Beispiel eine Präsenzpflicht. Dasselbe gilt für den Praxisteil, der 14 Monate dauert. In dieser Zeit sind die Studierenden einsatzfähig. Wir sind in der Hinsicht ein Vorläufer der Dualen Hochschule. Wir sind ein Erfolgsmodell, das es sich nachzuahmen lohnt.
Wenn man sich Ihre Stundenpläne anschaut, bekommt man schon den Eindruck, dass die Ausbildung sehr verschult ist. Muss das so sein?
Witt: Ob das so sein muss oder nicht, muss jeder für sich beurteilen. Es ist aber an Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Regel. Seit der Umstellung auf den Bachelor ist es sogar noch etwas verschulter, als es beim Diplom der Fall war.
Spielt die Forschung eine vergleichbare Rolle wie an der Universität?
Stöckle: Das kann sie gar nicht spielen, weil die Lehrverpflichtung bei uns mehr als doppelt so hoch ist wie an Universitäten. Und Forschung setzt voraus, dass man in Ruhe dran bleiben kann. Aber: Wir wollen uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften auch in Forschungsbereichen mit anderen Hochschulen vergleichen können. Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben einen großen Vorteil. Wir forschen nicht im luftleeren Raum. Die Forschungspalette unter anderem in Themenbereichen wie Arbeitsrecht, Coaching und Bürgerbeteiligung oder Europa, hier zum Beispiel was die Umsetzung von europäischen Richtlinien angeht, ist enorm breit.
Sind die Ziele der Bologna-Reform 2007 bei Ihren Bachelor- und Masterstudiengängen erreicht worden?
Stöckle: Ich finde, dass man das noch optimieren könnte. Der Ausgangspunkt der Bologna-Reform war ja der Wunsch nach Flexibilität. Man sollte leichter die Hochschule wechseln können, möglichst auch über Ländergrenzen hinweg. Es ging jedoch noch um etwas anderes. Der Bachelor sollte dafür sorgen, dass die jungen Leute nach dem Studium sofort einsetzbar sind. Gewollt waren eine größere Selbstständigkeit und ein höheres Maß an Eigenstudium. Die Flexibilität wird dadurch erreicht, dass man viele Modulprüfungen ablegt, die überall anerkannt sind, was einen Hochschulwechsel erleichtert. Die Kehrseite der Medaille: Man muss sehr viel lernen. Wir würden die Anzahl der Modulprüfungen gerne etwas abspecken. Deshalb haben Herr Witt und ich uns zusammen mit den kommunalen Landesverbänden an das Innenministerium gewandt, um wieder etwas mehr Luft zu schaffen für das Eigenstudium. Außerdem müssen unsere Professorinnen und Professoren den Studierenden mehr Selbstständigkeit abverlangen. Da haben wir noch ein gutes Stück des Weges vor uns.
Witt: Wenn ich ergänzen darf: Bei uns sind die Ziele der Bologna-Reform nicht zu 100 Prozent erreicht. Die Mobilität, beispielsweise in Richtung Ausland, scheitert daran, dass wir eine interne Ausbildung haben, die relativ stark auf Baden-Württemberg, aber auch den Bund, ausgerichtet ist. Die Verwaltungen in Frankreich, Südafrika und Australien funktionieren anders. Der Austausch von Modulen mit dem Ausland ist nicht möglich und eine größere Mobilität haben wir auch nicht erreicht, weil die Studierenden zu sehr eingespannt sind. Allerdings machen 50 Prozent unserer Studierenden ein Auslandspraktikum von drei Monaten. Das war aber schon zu Diplomzeiten so, ist aber im Vergleich zu anderen Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein hoher Prozentsatz.
War die Umstellung von Diplom auf Bachelor dann richtig?
Witt: Aus meiner Sicht ja. Wenn wir nicht umgestellt hätten, hätten wir den Anschluss an den Hochschulbereich verloren. Dann wären wir eine bessere Art von Berufsschule geworden. Das zweite Argument: Im angelsächsischen Raum ist das Diplom nicht bekannt. Kein Mensch weiß, was das ist. Bachelor und Master sind dagegen bekannt. Deshalb war es richtig, dass wir umgestellt haben.
Noch haben die Hochschulen keine Probleme, genügend qualifizierte Studierende zu finden. Den demografischen Wandel werden aber auch Sie spüren. Sind sie vorbereitet?
Witt: Den werden wir spüren, keine Frage. Deswegen müssen wir attraktiv bleiben, was das Studium anbelangt, was die Inhalte anbelangt, was die Studienbedingungen anbelangt, was die Jobaussichten anbelangt – und, was ganz wichtig ist, was die Bezahlung anbelangt. Deswegen kämpfe ich schon seit Jahren dafür, dass dieser Bachelorstudiengang ein interner Studiengang bleibt mit Bezahlung. Denn wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir einen massiven Einbruch in der Quantität und der Qualität der Bewerber. Wir haben jetzt noch die komfortable Situation, dass wir für unsere Studienplätze, die jetzt von 550 auf 700 erhöht werden, etwa 3500 Bewerbungen haben. Das bedeutet, dass wir auswählen können. Der demografische Wandel wird sicherlich zu einem Rückgang der Bewerberzahl führen. Aber ich glaube nicht, dass es so drastisch wird, dass wir zu wenige Bewerber haben werden.
Zurzeit studieren in Ludwigsburg 2000 junge Menschen. Für das Jahr 2015 prognostizieren sie 2300 Studierende. Wie wollen sie diese Herausforderung bewältigen?
Stöckle: Es ist sogar krasser: 2011 hatten wir 1600 Studierende. 2015 werden es 2300 sein. Also 700 mehr. Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir werden aber gut unterstützt von der Landesregierung. Die Innenverwaltung in Kehl und Ludwigsburg bekommt jeweils sechs zusätzliche Professorenstellen. Die Steuerverwaltung in Ludwigsburg bekommt fünf zusätzliche Professorenstellen. Man lässt uns also nicht im Regen stehen. Kehl und Ludwigsburg bekommen auch Geld für Lehrbeauftragte. Damit haben wir aber noch nicht die Raumfrage gelöst. Wir haben zusammen mit unserer Campus-Nachbarin in Ludwigsburg, der Pädagogischen Hochschule, einen Mehrbedarf von rund 2400 Quadratmetern. Das läuft hoffentlich auf einen Neubau hinaus. Das Problem ist noch nicht gelöst.
Der Frauenanteil unter den Studierenden beträgt rund 70 Prozent. Warum spiegelt sich das nicht in den Führungspositionen wieder?
Witt: Da sprechen Sie ein großes Problem an. Unter den Bürgermeistern gibt es bloß vier Prozent Frauen. Das hängt beim Bürgermeisterberuf in besonderem Maße damit zusammen, dass es dort besonders schwer ist, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Man sieht es an unserer Hochschule ganz deutlich: In unserem Vertiefungsschwerpunkt „Kommunalpolitik – Führung im öffentlichen Sektor“ sind immer weniger Frauen als Männer. In allen anderen Vertiefungsschwerpunkten dominieren die Frauen, nur in dem einen nicht. Das ist eigentlich schade. Die Frage, die ich mir stelle, lautet: Wie kann man die Bevölkerung dazu bringen zu akzeptieren, dass ein Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeister nicht auf jede Hauptversammlung gehen muss und dass er nicht jeden Repräsentationstermin persönlich wahrnehmen muss. Das wird nicht leicht. Die Bürgermeister sagen mir: Wenn ich mich da nicht sehen lasse, werde ich nicht mehr wiedergewählt.
Meinen Sie, dass es auch an den Frauen selber liegt, dass es so wenige Bürgermeisterinnen gibt?
Stöckle: Es liegt ganz sicher auch an den Frauen. Die meisten Frauen haben im Gegensatz zu den meisten Männern nicht Fußball spielen gelernt. Fußball zu spielen heißt, Teamplayer zu sein, Niederlagen einstecken, aber auch hart draufschlagen und nachher gemeinsam ein Bier trinken zu können. Und diese Eigenschaften haben Frauen nicht. Die müssen sie sich hart erarbeiten. Man muss zum einen vieles aushalten ohne zu jammern, man auch austeilen können, ohne dass einen dies tagelang beschäftigt. Und man muss ein gesundes Verhältnis zur Macht haben. Macht ist etwas wirklich Positives. Männer haben außerdem nach wie vor die besseren Netzwerke. Es liegt definitiv auch an den Frauen. Es gibt aber auch eine Reihe hochkompetenter Frauen, die sich nach oben gearbeitet haben. Sie stoßen dann auf die Angst vieler Männer vor weiblichen Führungskräften. Insofern liegt das nicht nur an den Frauen.
Die Einstiegsgehälter wurden gekürzt, die Pensionen scheinen nicht mehr sicher. Können Sie jungen Menschen heute noch guten Gewissens empfehlen, Beamte zu werden?
Witt: Noch tue ich es. Wenn es weiter so geht, wird es natürlich immer schwerer. Der Preis für das bezahlte Studium besteht unter anderem darin, dass unsere Absolventen in einer relativ niedrigen Eingangsbesoldung, nämlich A9, anfangen. Wenn Sie in A12 anfangen würden, dann würde ich sagen: Wir brauchen kein bezahltes Studium mehr und bekommen trotzdem genügend Studienbewerber. Die Absenkung von Einstiegsgehältern bringt jedoch zusätzlich einen Imageverlust mit sich. Das halte ich für sehr bedenklich.
Und wie sieht es mit den Pensionen aus?
Stöckle: Das spielt bei der Bewerbung keine Rolle. Das ist zu weit weg, danach werde ich nicht gefragt. Was im Übrigen zu wenig bekannt ist, ist das Tempo, mit dem man aufsteigen kann. Man redet immer von der Einstiegsbesoldung A9. Wenn Sie fleißig und ein bisschen begabt sind, brauchen Sie in einer Kommune nicht länger als zehn Jahre, um auf A12, A13 kommen. Wenn jemand ehrgeizig ist, kann er Bürgermeister werden. Dann kann er in der B-Besoldung kommen.
Was wünschen Sie Ihren Hochschulen für die Zukunft?
Stöckle: Ich wünsche mir eine sehr gute Fortsetzung der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, allen voran der Partnerhochschule in Kehl und mit Weiterbildungseinrichtungen. Ich wünsche mir die Entwicklung von Kooperationsstudiengängen mit der Führungsakademie in Karlsruhe und der Hochschule in Kehl. Ich wünsche mir, dass uns die Landesregierung weiterhin so hervorragend unterstützt, wie sie das gerade tut und weiterhin einen großen Rückhalt von Seiten der kommunalen Landesverbände. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Das würde ich gerne fortführen. Ich wünsche mir an der Hochschule ein noch kreativeres, noch offeneres Campusklima. Da sind wir Kehl ein bisschen hinterher. Ich möchte, dass bei uns mehr Hochschul- und Campusleben stattfindet. Mit mehr Abendveranstaltungen und mehr Spaß auch außerhalb des Studiums.
Witt: Ich stehe für einen weiteren Ausbau der Hochschule. Ich stehe für den Erhalt der Selbstständigkeit. Ich stehe für den internen Bachelorstudiengang, aber weitere externe Masterstudiengänge. Was ich sehr gerne ausbauen würde, ist der Bereich der Fort- und Weiterbildung. Da müssen wir noch mehr tun nach dem Motto „lebenslanges Lernen“. Dass wir unsere Absolventen auch nach ihrem Studium an die Hochschule binden. Das ist eine der wichtigsten Ziele für meine neue Amtsperiode, die sechs Jahre dauert.
Kontakt
 Ihre Ansprechpartnerin in der Redaktion
Ihre Ansprechpartnerin in der RedaktionPraktikums-Tagebuch
Studierende der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Ludwigsburg berichten über ihr Praktikum im Rahmen des Praxisjahrs im Vertiefungsschwerpunkt Kommunalpolitik/ Führung im öffentlichen Sektor beim Staatsanzeiger.
Der Kommunal-Newsletter

Wissenswertes zu kommunalpolitischen Themen für Sie als Gemeinderat/Gemeinderätin mit einem wöchentlichen Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Sie jetzt den
Kommunal-Newsletter.