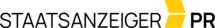Zu viele Modelle, zu wenig Effektivität bei der Sprachförderung beklagt
Stuttgart. Was bringen Sprachförderungen? Und wie soll mit Mehrsprachigkeit umgegangen werden? Auch über diese Themen wurde bei der Anhörung der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Landtag zum Thema „Interkulturelle Bildung“ gesprochen.
Die Debatte um Migration und Migranten ist in aller Munde. Und jeder Politiker meint, sich dazu äußern zu müssen. Dieser Tage meldete sich der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) zu Wort und sprach sich gegen eine zusätzliche Zuwanderung von Türken und Arabern aus. Für die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, Renate Rastätter, ein Eklat. „Damit heizt er die rechtspopulistische Debatte noch an“, erklärte sie bei der Anhörung „Vielfalt ist mehr wert - Interkulturelle Bildung in der Schule“, zu der sie in den Landtag Baden-Württemberg geladen hatte. Längst gebe es mehr Auswanderung als Einwanderung, auch bei türkischen Fachkräften. „Ein Alarmsignal, wir müssen auf Intergratiosbemühungen setzen. Es geht darum, das große brachliegende Bildungspotenzial und das gesellschaftliche kulturelle Potanzial der Migranten zu nutzen“, so Rastätter in ihrer Einführung.
Übergangsquoten auf weiterbildende Schulen
Immerhin haben im Land 33 Prozent der Unter-18-Jährigen einen solchen Hintergrund. Deren Benachteiligung zeige sich unter anderem darin, dass im Land derzeit auf die Hauptschule über 50 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund übergehen nach der Grundschule, aber lediglich 20 Prozent Kinder ohne Migrationshintergrund. Die Übergangsquote bei den Gymnasien sei genau umgekehrt. Und das liege nicht am mangelnden Bildungswillen der Eltern, wie eine Studie der Universität Mannheim zeige. Sie könnten ihre Kinder nicht in dem Maße unterstützen. Das selektive Bildungssystem tue sein Übriges hinzu. Etwas aufgefangen werde diese Bildungsungerechtigkeit durch das berufliche Schulwesen, so Rastätter. „Aber die Versäumnisse liegen in der Politik auf Länderebene.“
Dass sich türkische Eltern für ihre Kinder am liebsten das Abitur oder die Fachhochschulreife als Abschluss wünschten, und zwar in weit höherem Maße als deutsche Eltern, sei seit langem bekannt, bestätigte denn auch Petra Stanat, empirische Bildungsforscherin und Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität Berlin. „Doch das sind unrealistische Erwartungen. Wir wissen auch nicht, was die Eltern meinen, wenn sie das sagen“, so Stanat. Ein Forscher verweise hier auf „Immigrant Optimism“, also auf den Optimismus der Einwanderer.
Zu wenig valide Erkenntnisse vorhanden
Klar sei, dass Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligt seien, aber weniger klar, warum das so ist. Laut Stanat habe man zu spät angefangen, Daten zu sammeln und auszuwerten, um valide Erkenntnisse zu bekommen, da man immer in der Illusion lebte, kein Einwanderungsland zu sein. Auch gebe es Unterschiede zwischen den verschiedenen Migrantengruppen. Und so habe man auch keine exakten Daten, ob wirklich Schüler ausländischer Eltern mit gleichen Leistungen diskriminiert würden, also seltener eine Gymnasialempfehlung bekommen, als die deutscher Eltern. „Wir haben den Eindruck, dass bei gleichen Leistungen Schüler mit Migrationshintergrund tendenziell häufiger in das Gymnasium übergehen.“
Lediglich im berufsbildenden System sei eindeutig, dass sie schwerer Ausbildungsplätze bekämen – und dort seien auch Mädchen mit Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert. Was die Forschungen auch zeigten, sei der Zusammenhang mit dem sozio-ökonomischen Status der Eltern: Ob deutsch oder mit Migrationshintergrund, Kinder aus bildungsfernen Haushalten gingen eher in die Hauptschule. Das Vorwissen und die soziale Vorbildung spiele eine Rolle. „Und so kann es schon sein, dass Lehrer eher einem Kind aus einem bildungsnahen Elternhaus eine Gymnasialempfehlung geben, als dem anderen aus einem bildungsfernen Haushalt“, so Stanat. Klar sei daher, man müsse die Kinder früh im Verlauf der Gundschule bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen unterstützen, nicht allein Sprachförderung betreiben.
Zu wenig Effektivitätsprüfungen bei der Sprachförderung
„Das Frustrierende ist, dass wir nach über neun Jahren immer noch zu wenig wissen, also auswerten können, was effektive Sprachförderung ist“, sagt die Forscherin. „Es gibt zu viele Modellprojekte, wenig Effektivitätsprüfungen. Es ist an der Zeit, nachhaltig zu arbeiten, einen kohärenten Kern der Förderung zu entwickeln und flächendeckend einzurichten. Wir müssen sicherstellen, dass wir die gleiche Sprache sprechen.“
Denn auch in Sachen Forschung zum Stellenwert der Muttersprache für die schulische Entwicklung, den Zweitsprachenerwerb sowie der Mehrsprachigkeit scheint noch babylonisches Forschungswirrwarr zu herrschen. „Es gibt unterschiedliche Meinungen und Ansätze“, so Havva Engin, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg.Allerdings habe man herausgefunden, dass das Gehirn verschiedene Sprachzentren anlege, wenn unter drei Jahren die Mehrsprachigkeit gefördert werden. „Ab neun Jahren bildet das Gehirn Strukturen in anderen Regionen aus“, so Engin.
Zusammenhang zwischen Niveau bei Muttersprache und Zweitsprache
Auch zeige sich, dass Kinder mit hohem Erstsprach-Niveau, also einem guten Niveau in der Muttersprache, eine besseren Wortgebrauch in der Zweitsprache hätten. „Und das hat wiederum, so bestätigen Sprachstandsdiagnosen, mit der Bildungsarmut zu tun. Kinder bildungsferner Familien haben einen anderen Start. Wir müssen den Spracherwerb ent-ethnisieren.“ Ein Versagen in beiden Sprachen liegt daran, dass in Erstsprache aufgrund Bildungsferne nicht gefördert werde, also nicht gelesen, richtig gesprochen oder Bilderbücher angeschaut würden. Studien zeigten, dass im niedersten ökonomischen Status insgesamt 25 Stunden vor der Kindergartenzeit vorgelesen wurde, im höchsten Status 1000 Stunden, in ersterem kannte das Kind 13 Millionen Wörter, im letzterem 45 Millionen Wörter.
Engin fordert daher frühe phonologische Trainings in Erst- und Zweitsprache oder „Familiy Literacy“ zu fördern, also die Eltern, besonders die Mütter zu animieren, mit den Kindern Bilderbücher zu betrachten. Schließlich müssten in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen Kinder mit Migrationshintergrund wertgeschätzt und aktiv deren Sprachentwicklungsprozesse wahrgenommen werden: „Man sollte wissen, wann, zu welcher Tageszeit, und über welches Thema wird mit dem Kind in welcher Sprache gesprochen.“
Kontakt
 Ihre Ansprechpartnerin in der Redaktion
Ihre Ansprechpartnerin in der RedaktionPraktikums-Tagebuch
Studierende der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Ludwigsburg berichten über ihr Praktikum im Rahmen des Praxisjahrs im Vertiefungsschwerpunkt Kommunalpolitik/ Führung im öffentlichen Sektor beim Staatsanzeiger.
Der Kommunal-Newsletter

Wissenswertes zu kommunalpolitischen Themen für Sie als Gemeinderat/Gemeinderätin mit einem wöchentlichen Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Sie jetzt den
Kommunal-Newsletter.