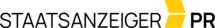Hauptschule Thema der Regierungsbefragung

Kultursministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD). Foto: Staatsministerium
Stuttgart. Die grün-rote Landesregierung hat nicht vor die Hauptschulen in Baden-Württemberg abzuschaffen. Das erklärte Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer in der Regierungsbefragung am Mittwoch im Landtag. Der frühere Kultusstaatsekretär Georg Wacker (CDU) hatte zuvor von Irritationen in den Schulen gesprochen, die das Ministerium mit verschiedenen Äußerungen in den vergangenen Tagen ausgelöst habe.
So habe der Leiter der Stabsstelle für Gemeinschafts-, Modellschulen und Inklusion im Kultusministerium, Norbert Zeller (SPD), in der vergangenen Woche in Ludwigsburg bei einer Tagung davon gesprochen, dass alle Hauptschulen zu Werkrealschulen würden. Zudem habe ein Formblatt des Ministeriums an die Grundschulen für die unverbindliche Übertrittsempfehlung für Verwirrung gesorgt, so Wacker. Denn auf diesem sei die Hauptschule als Schulform gar nicht mehr aufgeführt. Für die Lehrer an den Hauptschulen im Lande, die eine gute Arbeit machten, sei dies ein Schlag ins Gesicht.
Warminski-Leitheußer korrigierte die Aussage ihres Stabstellenleiters. „Es hätte heißen müssen: Alle Hauptschulen können Werkrealschulen werden“, betonte sie vor dem Landtag und bezeichnet die Äußerung als Versprecher. Von dem Formblatt habe sie keine Kenntnis, werde dies aber überprüfen. Alle existierenden Schulformen müssten aber natürlich auf diesem Blatt erscheinen, sagte die Ministerin.
Auch wenn die Hauptschule nicht sofort zur Disposition steht, strebt grün-rot ein zweigliedriges Schulsystem an. Grundkonzept sei die Schüler mindestens zu einem mittleren Bildungsabschluss zu führen. Um dies voranzubringen können ab dem nächsten Schuljahr auch einzügige Hauptschulen zu Werkrealschulen werden. Zudem ist die Einrichtung einer 10. Klasse möglich, die entweder zur mittleren reife oder zum Hauptschulabschluss nach zehn Jahren führen soll. Für eine solche 10. Klasse würden mindestens 16 Schüler gebraucht, erklärte Warminski-Leitheußer auf Nachfrage des CDU-Abgeordneten Joachim Kößler. Ein neuer Bildungsplan für diese 10. Klasse ist nach Aussage der SPD-Politikerin in Arbeit.
Entschädigungsfonds für Opfer der Heimerziehung
Zur Finanzierung des Entschädigungsfonds für Opfern der Heimerziehung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten muss Baden-Württemberg 6,16 Millionen Euro beisteuern. Das sehe die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vor, die das Kabinett nun gebilligt habe, erklärte Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) in der Regierungsbefragung. Der Fonds mit einem Volumen von 120 Millionen Euro werden je zu einem Drittel vom Bund, sowie den Ländern und in Westdeutschland getragen.
Zudem sollen in den Ländern regionale Anlauf- und Beratungsstellen für die Betroffenen eingerichtet werden, erläuterte Altpeter. Dies gehe ebenso wie der Fonds auf die Empfehlungen des Runden Tisches des Bundestags zur „Heimerziehung in der Nachkriegszeit zurück“. Wie viele Kinder und Jugendliche in den Kinderheimen großes Leid zugefügt worden sei, sei nicht bekannt, so die Ministerin.
Wo die Beratungsstelle angesiedelt werden soll, ist derzeit noch offen. Denkbar sei entweder bei einem Regierungspräsidium oder beim Kommunalverband Jugend/Soziales, sagte Altpeter. Dies solle in Abstimmung mit den Vertretungen der Opfer geklärt werden. Zum Betrieb der Beratungsstellen entstehen dem Land pro Jahr rund 100 000 Euro Kosten. Die Beratungsstelle soll Betroffenen bei der Beantragung von Entschädigungsleistungen helfen, therapeutische Angebote vermitteln sowie Gesprächsrunden initiieren.