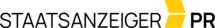Nur CDU steht uneingeschränkt hinter Landarztquote
Stuttgart. Heftige Kritik hat die Opposition am von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) eingebrachten Gesetzentwurf zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung geübt. Unter anderem wird darin geregelt, die Hälfte der neuen dauerhaft eingerichteten 150 Medizinstudierendenplätze im Land nicht nach Abiturnoten zu vergeben. Allerdings müssen sich Interessenten, die auf diese Weise zum Zuge kommen möchten, verpflichten, für zehn Jahre in unterversorgten Regionen Baden-Württembergs tätig zu sein. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, muss bis zu einer Viertelmillion Euro Strafe zahlen.
„Vermutlich heißt das Gesetz Landarztgesetz, weil Ärztinnen darin gar nicht vorkommen“, so der FDP-Abgeordnete Jochen Haußmann am Donnerstag im Landtag. 70 Prozent der Medizinstudierenden seien weiblich, der Entwurf aber ein familienpolitisches Armutszeugnis, weil auf deren Bedürfnisse nicht eingegangen werden, sondern zur Verpflichtung auch gehöre, zehn Jahre in Vollzeit zu arbeiten.
„Das ist ein Gesetz für die Tonne“, erklärte auch der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Hinderer. Die Landarztquote wolle niemand außer der CDU. Die habe zwar im Laufe der Legislaturperiode so manche grüne Kröte schlucken müssen, jetzt komme aber eine ganz große Kröte für die Grünen zurück. Hinderer verwies auch auf die Anhörungsergebnisse: „Es ist aus meiner Sicht ein Skandal und grenzt schon an Verschleierungstaktik, dass die äußerst kritischen und ablehnenden Stellungnahmen sämtlicher Expertinnen und Experten nicht umfänglich und deutlich im Gesetzentwurf dargestellt wurden.“ Mit der teuren, ineffektiven und nicht zielführenden Symbolpolitik würden die hausärztlichen Versorgungsprobleme auf dem Land "ganz bestimmt nicht gelöst", weil es angesichts von Studienzeiten von zehn Jahren und mehr viel zu lange dauern werde, bis die Maßnahme greifen könne.
LANDARZTGESETZ SEI "WIDERSINNIGE SYMBOLPOLITIK"
Haußmann sprach von „widersinniger Symbolpolitik“. Wenn in Zukunft jährlich bis zu 75 Studienplätze daran geknüpft würden, dass sich junge Menschen zur Hausarzttätigkeit in unterversorgten Gebieten verpflichten, helfe das aktuell überhaupt nichts; „Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass junge Leute ihr Leben schon 15 Jahre im Voraus abschätzen können?“ Es müsse zu denken geben, wenn die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland die Landarztquote mit guten Argumenten ablehnt und darauf hinweist, dass diese Quote auch sozialpolitisch in hohem Maße ungerecht ist. Für die FDP stehe fest, dass „eine gute ärztliche Versorgung gelingt nur, wenn die Attraktivität des Arztberufs wiederhergestellt wird“.
Die Grünen hatten sich lange Zeit gegen die Quotenregelung gewehrt, schlussendlich aber doch eingewilligt, um die neuen Studienplätze insgesamt schaffen zu können. „Es ist kein Geheimnis, dass wir einer Landarztquote eher skeptisch gegenüberstehen“, bekannte Petra Krebs. Wichtig sei vor allem, die landärztliche Versorgung durch eine systematische Stärkung der Allgemeinmedizin in Kombination mit einem Landarztförderprogramm zu stärken. Dazu gehöre unter anderem das neu gegründete Neigungsprofil „Ländliche Hausarztmedizin“ im Studium und eine stärkere Vernetzung mit den akademischen Lehrkrankenhäusern und Lehrpraxen.
So würden Studierende schon früh für eine hausärztliche Tätigkeit begeistert und mit entsprechenden regionalen Akteurinnen und Akteuren, wie zum Beispiel Bürgermeistern und Landräten zusammengebracht. Wichtig sei zudem, dass dieser Ausbildungsweg in Zukunft jedes Jahr allen 1650 Medizinstudienanfängern offenstehe. Auch der Sozialminister selber bezeichnete die Quote als nur einen Teil der Gesamtstrategie: „Wir haben zu einem ganzen Strauß von Maßnahmen eine weitere hinzugefügt“.
Für die AfD kritisiert Christina Baum, dass nicht schon viel früher auf die Entwicklung reagiert worden ist, denn „die Altersstruktur ist kein Überraschungspaket“. Notwendig seien Maßnahmen, „die schnell greifen, denn den Mangel haben wir jetzt“. Christine Neumann-Martin (CDU) lobte dagegen die Möglichkeit sicherzustellen, der Kernaufgabe staatlicher Daseinsvorsorge gerecht zu werden, „der medizinischen und pflegerischen Versorgung, gerade im ländlichen Raum".